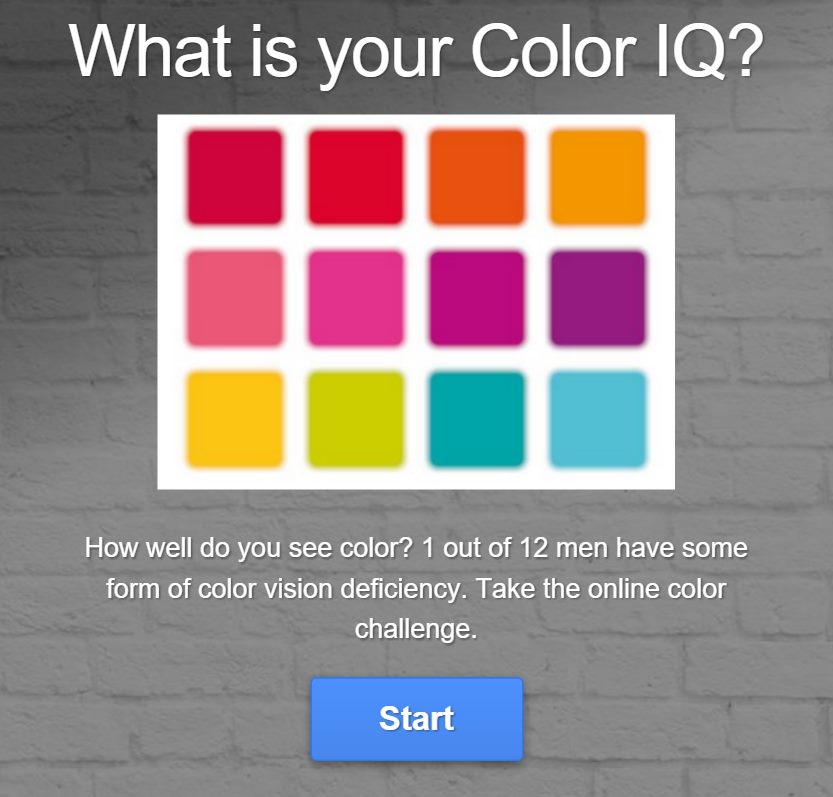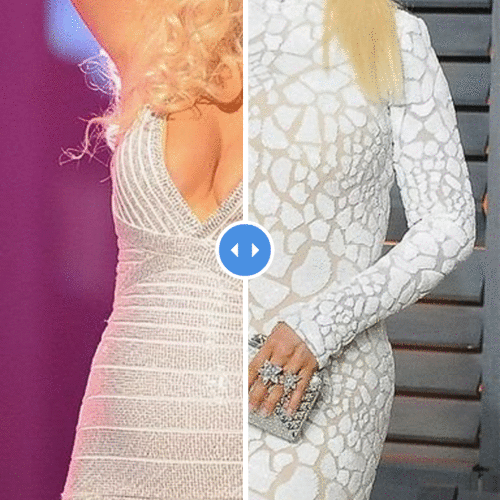Burgerbibliothek Bern
Description
Die Burgerbibliothek Bern ist ein Kulturinstitut der Burgergemeinde Bern im Dienste der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit. Die Burgerbibliothek Bern ist die Bibliothek und das Archiv der Burgergemeinde Bern. Sie sammelt und bewahrt zahlreiche wertvolle und international bedeutende Bestände an Manuskripten, Archivalien und Bilddokumenten.
Die Burgerbibliothek Bern existiert seit 1951 und verdankt ihre Gründung der Umwandlung der damaligen Stadt- und Hochschulbibliothek (heute Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek Bern) in eine Stiftung. Dabei verselbständigte man deren Handschriftenabteilung, indem man eine unabhängige Burgerbibliothek errichtete. Heute ist die Burgerbibliothek Bern ein öffentliches wissenschaftliches Archiv.
Zu den bekanntesten Sammlungen zählen die mittelalterlichen Bongarsiana/Codices und die Archivalien zur Schweizer und Berner Geschichte mit Nachlässen bedeutender Persönlichkeiten wie Albrecht von Haller und Jeremias Gotthelf. Die Burgerbibliothek ist auch Archiv der Burgergemeinde Bern und der burgerlichen Gesellschaften und Zünfte.
Tell your friends
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.comDer lachende Dritte In seinem Testament bestimmte ein 1922 verstorbener Erblasser das Burgerspital und dessen Pensionäre zu seinen Haupterben. Zu dieser Ehre kam das Burgerspital nicht etwa aufgrund seiner überragenden Qualitäten als Alters- und Pflegeheim, sondern vielmehr wegen der familiären Verhältnisse beim Erblasser. Die Begründung für die Verfügung lässt tief blicken. Immerhin kamen so die Pensionäre zu „Kaffee mit Strübli und Chümikuchen“, bei dessen Verzehr sich diese lachenden Dritten hoffentlich amüsierten.
Heimehus ohne Datum Dieses wenig bekannte Gebäude geht in seinem Kern auf die Zeit um 1200 zurück, ist also etwa gleich alt wie die Stadt Bern. Es liegt etwas südlich vom Dorfkern von Kirchlindach, und nur wenige Meter trennen es vom Chräbsbach. Im Verlauf der Jahrhunderte wurde es immer wieder umgebaut und erweitert. Die Denkmalpflege bezeichnet es als „baugeschichtlich und typologisch sehr wichtigen Bau“. Möglicherweise diente es ursprünglich dem adligen Geschlecht der von Lindenach als Stammsitz. Während mehrerer Jahrhunderte gehörte es verschiedenen bernburgerlichen Familien. Seit 1822 befindet es sich im Besitz der Familie von Christian König und seinen Nachfahren. Burgerbibliothek Bern, FPa. 14, Nr. 64
Dampftram in Wabern 1894-1902 Das Zeitalter des Trams begann in Bern 1890 mit der Eröffnung der Linie Bärengraben-Bremgartenfriedhof. Als einzige in Bern erhielt sie ein Tram, das mit Luftdruck fuhr. Auch die nächste Linie blieb ein Einzelfall: Ab 1894 verkehrte das Dampftram von der Länggasse über den Bahnhof und den Eigerplatz nach Wabern. Von dort konnte man per Pferde-Omnibus nach Kehrsatz weiterfahren. Dieser Kurs erlag allerdings im Herbst 1901 der Konkurrenz durch die neu eröffnete Gürbetalbahn. Alle seither eröffneten Tramlinien wurden mit Strom betrieben. Die Umstellung der Länggasse – Wabern-Linie auf elektrischen Betrieb erfolgte 1902. Die Linie rentierte gleich von Anfang an, und der Bau der Gurtenbahn(1899 eröffnet) brachte weitere Passagiere. Das Tram auf dieser Aufnahme steht vor der „Kanadischen Baumschule“ von Philipp Gosset (1838-1911) auf dem ehemaligen Schönaugut in Wabern (heute Haltestelle Gurtenbahn). Burgerbibliothek Bern, AK.1617 Weitere Infos zum Waberntram finden Sie im Historisch-Topographischen Lexikon der Stadt Bern: http://archives-quickaccess.ch/search/bbb/lexikon
Digitalisate der Kirchenbücher des Berner Münsters online In den Kirchenbüchern des Berner Münsters wurden Taufen und Ehen ab 1530 sowie Todesfälle ab 1719 von burgerlichen Personen verzeichnet. Die 42 Rodel sind für die Burgerkammer (später Burgerkanzlei) hergestellte Abschriften. In den Genealogien Burgerlicher Geschlechter der Stadt Bern hat Bernhard von Rodt (1892-1970) in 7 Bänden alteingesessene und namhafte Bernburger-Familien in Genealogien zusammengefasst. Die Digiatlisate zu diesen Bänden sind nun vollständig mittels Viewer online zugänglich und können im Zugang über „Archives Quickaccess“ abgerufen werden. Als Ergänzung zur Personen- und Familiengeschichte können die Wappen der Burgergemeinde Bern, die Porträts in der Burgerbibliothek Bern oder die Deskriptorensuche nach Personen im Online-Archivkatalog konsultiert werden. Zudem hat das Staatsarchiv Bern die Kirchenbücher des Kantons Bern bereits online zur Verfügung gestellt. https://www.archives-quickaccess.ch/search/bbb/kirchenbuecher
Neues im Online-Archivkatalog Die Burgerbibliothek Bern hat weitere Beschreibungen von Archivbeständen im März 2018 online geschaltet: - Sektion Bern des Schweizer Alpen-Clubs (GA SAC Bern): Bereits seit 2012 ist in der Burgerbibliothek das Zentralarchiv des SAC zugänglich. Dieses wird nun exemplarisch durch das Archiv der Sektion Bern ergänzt, das die konkrete Vereinstätigkeit (Touren, gesellige Anlässe etc.) auf lokaler und regionaler Ebene dokumentiert. Der Bestand enthält auch das Archiv der Sektion Bern des ehemaligen Schweizerischen Frauen-Alpen-Clubs. - Die Vereinigung Berner Division pflegt die Erinnerung an die 1875-2003 bestehende „Berner Division“ (zuletzt Felddivision 3). Neben den Unterlagen des Vereins enthält der Bestand einige interessante Fotoalben zur Division (GA VBD). - 58 bislang nicht dokumentierte Porträts konnten neu in die Porträtdokumentation aufgenommen werden. 52 dieser Porträts befinden sich in Privatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit unzugänglich. - Der erschlossene Nachlassteil des Musikers, Komponisten und Dirigenten Walter Furrer (1902-1978)umfasst vornehmlich Verlagskorrespondenz, Verlagsverträge aber auch Musikerbriefe sowie Kritiken zu seiner Dirigententätigkeit. Die Musikalien sind noch nicht bearbeitet (N Walter Furrer). - Der Bestand der langjährigen Besitzer der Papiermühle in Worblaufen, Familie Gruner, umfasst v.a. Papiere aus dem privaten Bereich wie Korrespondenz, Tagebücher, Gedichte oder Fotos (FA Gruner). - Im Bereich Bongarsiana/Codices wurden 50 weitere Handschriften (Cod. 161-210) erschlossen, darunter einige der wichtigsten Textzeugen mit spätantiken Kommentaren (sog. Scholaria Bernensia) zu Werken des römischen Dichters Vergil (Cod. 165, 167, 172). Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Lesesaal, wo Sie unsere Archivalien konsultieren können.
Stockeren-Steinbruch um 1900 1708 begann die Ausbeutung in den Stockeren-Steinbrüchen. Ursprünglich gewann man den Sandstein im Tagebau. 1863 weitete man den Abbau in den Untergrund aus; es entstanden mehrere Kavernen, eine davon mit einer Tiefe von 50 m und einer mittleren Höhe von 20 m. Als am 6. August 1869 ein Teil der Felswand einstürzte, die den Steinbruch begrenzte, fanden 11 Arbeiter den Tod. Nachdem die Kaverne nicht mehr weiter ausgebaut wurde, richteten sich einige Familien dort ihre Wohnungen ein. Allzu komfortabel dürften sie nicht gewesen sein: sie verfügten weder über einen Wasseranschluss noch über eine Kanalisation. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts gaben die Besitzer die Steinbrüche einen um den andern auf. Ein Teil der Kavernen wurde ab 1949 als Brennstofflager für Notzeiten verwendet. Burgerbibliothek Bern, FP.B.431
Der Winter 1962/1963 war mit Abstand der kälteste des 20. Jahrhunderts. Seither gab es keinen auch nur annähernd so kalten Winter mehr. Viele Seen froren ganz zu, so etwa der Zürichsee, der Bodensee und eben auch der Bielersee. Beim Thunersee allerdings reichte es nicht ganz; da bildete sich nur in der oberen Hälfte des Sees eine durchgehende Eisdecke. Die leeren Speicherseen führten zu Engpässen bei der Stromversorgung, so dass die SBB während längerer Zeit die Waggons tagsüber nicht mehr heizten. Transportschwierigkeiten hatten auch einen Mangel an Heizöl zur Folge. Aber die gefrorenen Seen zogen Hunderttausende an, die sich dem garstigen Wetter zum Trotz auf dem Eis vergnügten. Die hier gezeigten Aufnahmen stammen aus dem Archiv des Burgerspitals und sind um die Sankt Petersinsel herum entstanden. Der Fundort der Fotos mag überraschen, aber da die Sankt Petersinsel dem Burgerspital gehört, hat sich dort im Lauf der Zeit viel (Bild-)Material zur Insel angesammelt.
Noch haben wir nicht so viele Fans, wie hier Soldaten im Karree stehen, aber das wird noch! Herzlichen Dank den 900, die uns inzwischen schon folgen! (Fahnenabgabe vor dem Bundeshaus in Bern am 19. August 1945, Signatur: FP.H.4)
Quiz