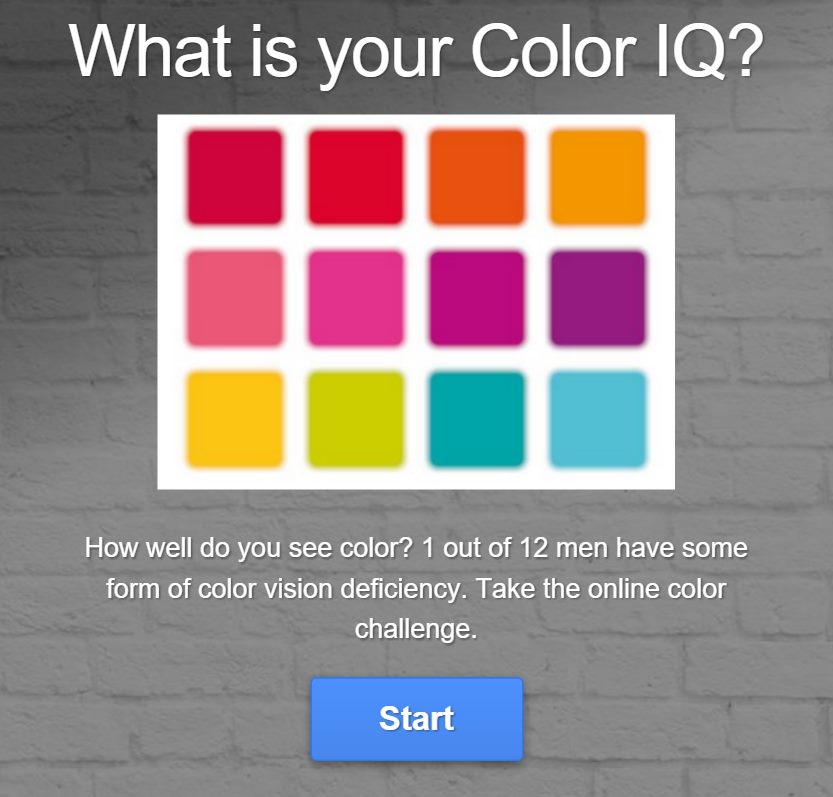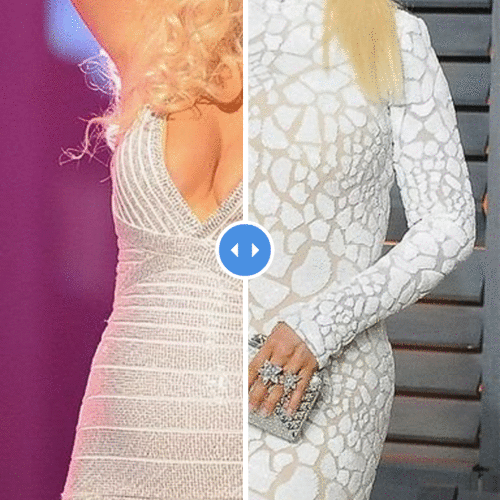Sozialistisches Patientenkollektiv & Akademie Dialektik
Description
Tell your friends
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.com🌀👻🌀
Wider das Positive🌀👻🌀 Günther Anders – Philosophische Stenogramme: “Der Nachweis, dass es die Welt (oder die Menschheit, oder gar ein bestimmtes Volk) geben sollte; dass also deren Dasein "moralisch" sei, deren Nichtdasein dagegen "unmoralisch" wäre, der kann niemals erbracht werden – eben sowenig wie der, dass "Sollen sein soll". Philosophen, die derartige Nachweise zu führen versuchen würden, wären metaphysisch albern. Ausdrücklich bestritten wird diese Unmöglichkeit zwar niemals, aber nur deshalb nicht, weil diese Fragen kaum je auch nur gestellt werden. Kein Wunder also, dass aus der Unmöglichkeit auch niemals Konsequenzen gezogen werden. Halbe Konsequenzen mag es zwar geben: so scheint z.B. der naturwissenschaftliche Begriff der "Wertfreiheit" ungefähr in dieselbe Richtung zu weisen. Aber da dieser Begriff rein wissenschaftstheoretisch bleibt, also nicht eigentlich von unserer Welt spricht, sondern nur von der Methodik der Forschung, bleibt auch er konsequenzlos. Die radikale Konsequenz aus der Einsicht heißt: Moralischer Nihilismus. Das einfache Argument lautet: Was auf der selber schwebenden Erde zu stehen scheint, das schwebt gleichfalls. Unbildlich: Da das "Seinsollen" der Welt (bzw. der Menschheit etc.) nicht begründet werden kann; da es andererseits keine moralischen Gebote oder Verbote gibt oder geben kann, die sich nicht auf die Binnenverhältnisse in der Welt, bzw. in der Menschheit beziehen, können auch diese nicht begründet oder abgeleitet werden. Auch sind sie mithin, metaphysisch gesehen, unverbindlich; und Ethik bleibt eine utopisches Unternehmen. Diese katastrophale Folgerung darf nicht unterschlagen werden. Auch nicht von denen unter uns, die als "professionelle Moralisten" gelten oder als solche wirklich leben, und die aus ihrer Entrüstung über moralisch Empörendes keinen Augenblick herauskommen. Indignation beweist nichts. Und weder uns selbst noch anderen dürfen wir die Tatsache, dass wir "brennen", als ernsthaftes Argument, also als Beweis für die Existenz und Verbindlichkeit moralischer Forderungen weismachen. Im Gegenteil: Gerade uns kommt es zu, diese katastrophale Wahrheit unverblümt auszusprechen. Denn nur uns wird man, da wir uns damit ja ins eigene Fleisch schneiden, Glauben schenken. Und wenn man auf diejenigen warten wollte, die Moralwörter ohnehin immer nur auf unverbindliche Art in den Mund nehmen (bzw. dann, wenn ihnen das opportun scheint, von der "ewigen Geltung der Werte" schwätzen), dann würde man lange warten können. Obwohl als "Berufsmoralist" verhöhnt, bin auch ich also ein Nihilist. Und als solcher in Verruf zu geraten, ist mir tausendmal lieber, als von Falschen für angebliche "ethische Fundamentaleinsichten" gute Noten zu erhalten. Es wäre mir äußerst peinlich, eines Tages die Entdeckung zu machen, dass ich mein metaphysisches Credo allein meinem Zorn verdanke; dass ich die "Gesolltheit" der Existenz von Welt und Menschheit allein deshalb, weil ich "brenne" – kurz: dass ich ein "Platonist der Entrüstung" bin. - Kant war dieser Schritt zum Nihilismus fremd. Jene Seite, auf der er das Unmoralische durch logischen Widerspruch definiert (z.B. die Unmoralität von Vertrauensbrüchen dadurch, dass, wenn jedermann Vertrauen bräche, Verträge, und damit bürgerliche Gesellschaft, nicht existieren könnten), verbirgt zwei Unterstellungen, die basislos bleiben, und die sich niemals werden beweisen lassen. 1. Die Unterstellung, dass Widerspruch nicht sein soll; und 2. Die Unterstellung, dass (auf Verträgen beruhende) Gesellschaft "sein soll". Selbst wenn die erste Unterstellung zuträfe, die Gültigkeit der zweiten wäre damit nicht bewiesen: Denn warum der Gedanke, dass es keine Gesellschaft gibt, einen Widerspruch darstellen oder enthalten sollte, das ist unerfindlich. Allein Hegel, der diese Sätze Kants angreift, sogar verhöhnt, hat die Folgerichtigkeit besessen und den Mut aufgebracht, den Moralnihilismus auszusprechen. In seinen "Grundlinien der Philosophie des Rechts" heißt es: "Dass kein Eigentum stattfindet, enthält für sich ebensowenig Widerspruch, als dass dieses oder jenes einzelne Volk, Familie u.s.f. nicht existiere, oder dass überhaupt keine Menschen leben". Illusionsloser ließe sich diese Wahrheit gar nicht aussprechen, Hegels Satz steht. Das zu betonen, ist aus Fairness geboten, denn sein so oft als konformistisch, wenn nicht sogar schlimmer, gelästerter Schritt von der "Moralität" zur "positiven Sittlichkeit", und damit zur Sanktionierung dessen, was "ist", muss vor der Folie dieses seines Mutes zum Nihilismus gesehen werden. Unsere Aufgabe ist nun nicht nur, Hegels positiv nihilistische Einsicht durchzuhalten, ohne dabei der Verführung, der er nachgab: nämlich dem Desperadoschritt aus dieser Einsicht ins angeblich "Positive", ebenfalls nachzugeben; sondern sogar, trotz unseres Wissens, das letzte Sanktionierungen moralischer Postulate niemals aufgefunden werden können, doch moralistisch, und das heißt heute: non-konformistisch, zu bleiben. Als regulative Maxime gilt also: "Sei moralisch, obwohl du, dass "Sollen sein soll", nicht begründen kannst, nein sogar für unbegründbar hältst." [13] - Die atomare Drohung S.137
Friedrich Pollock, der “garantierte“ Kapitalismus und die Systemrelevanz🙋 Friedrich Pollock (* 22. Mai 1894 in Freiburg im Breisgau; † 16. Dezember 1970 in Montagnola, Tessin, Pseudonym teilweise Karl Baumann) war ein deutscher Soziologe und Ökonom. Er war Mitbegründer des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. [...] Pollocks ökonomische Analysen leisteten einen maßgeblichen Beitrag zum Theoriebildungsprozess der philosophischen Hauptvertreter der „Frankfurter Schule“ und gaben einen wichtigen Impuls zur Formulierung der „Dialektik der Aufklärung“ durch Horkheimer und Adorno. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Pollock
Die Unendlichkeit ist lang, vor allem gegen Ende🌀👻🌀 “Daß wir uns selbst als widerspruchsfrei ansehen, bedeutet auch, daß wir in der Mannigfaltigkeit unserer Gedanken eine Einheit […] bemerken. Darum weist auch das Selbstbewußtsein, um das es hier geht, auf Paradoxien hin –zumindest im Fall der Mengentheorie. Wir sind stets im Begriff, einen einzelnen einheitlichen Gegenstand für unsere Gedanken anzusetzen, die Menge aller Mengen. Wenn wir eine bestimmte (unvollständige) axiomatische Grundlage der Mengentheorie haben, dann können wir all die Mengen verwenden, deren Existenz auf dieser Grundlage bewiesen werden kann, und anschließend die Existenz einer Menge zugestehen, die alle diese Mengen enthält. […] Aber dann wird diese neue, erweiterte Grundlage derselben Behandlung unterliegen. Die vollständige Hierarchie muß sich in ihrer Unendlichkeit für immer unserem Zugriff entziehen. Sie muß sich unserem Zugriff sogar dann entziehen, wenn wir den Standpunkt desjenigen vollen Selbstbewußtseins erreichen, auf dem wir sagen wollen, daß es genau dies [die vollständige Hierarchie] ist, was wir im Blick haben.“ Adrian Moore, The Infinite, S. 181 f. “Wer in der Lebenswelt lebt, ist sich dessen vor der Bekanntschaft mit philosophischen Theorien der Lebenswelt nicht bewußt; andernfalls lebte er nicht in derjenigen Lebenswelt, auf die diese Theorien hinauswollen. Wer in der Lebenswelt lebt, erkennt andererseits aber auch ohne weitere Reflexion die Geltung von Wissenschaft, Mathematik und Logik an. Eine Lebenswelt, in der keine Logik vorkommt, ist eine Erfindung der Philosophie, eine bloße Fiktion. Daraus folgt nicht, daß die unreflektierte Anerkennung der Wissenschaften und die Wissenschaften selbst von jeglicher Kritik freizustellen wären, ganz im Gegenteil. Es spricht aber dagegen, formale Argumentationen allein mit dem Verweis auf die lebensweltliche Alltagspraxis zurückzuweisen. Die begrifflichen und methodischen Grundlagen der logischen Erfassung unserer Begriffspraxis stürzen sich von selbst in eine selbstzerstörerische Krise. Die besten verfügbaren logischen Theorien zeigen mit ihren eigenen Mitteln, daß unsere elementaren Begriffe von absolut unendlich großen Totalitäten inkonsistent sind. Wir sollten also auch versuchen, diejenigen Lösungswege aufzuzeigen, die sich unter Verwendung dieser Mittel selbst ergeben.“ Guido Kreis - Negative Dialektik des Unendlichen
Hegels erste Habilitationsthese: »Contradictio est regula veri, non contradictio, falsi🌀👻🌀« GWF Hegel In der Differenzschrift von 1801 heißt es: »Die Antinomie, der sich selbst aufhebende Widerspruch, ist der höchste formelle Ausdruck des Wissens und der Wahrheit.« (GWF Hegel) - So mitgeteilt von Karl Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben, Berlin 1844, Nachdruck Darmstadt 1977, S. 156. Die plausibelste Lesart dieses Satzes hat Hans Friedrich Fulda vorgeschlagen: »Der Widerspruch ist die Regel des Wahren, nicht ist der Widerspruch die Regel des Falschen« (vgl. ders., »Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik«, in: R.-P. Horstmann (Hg.), Dialektik in der Philosophie Hegels, Frankfurt/ M. 1978, S. 33-69, hier: S. 37); vgl. außerdem die Deutung von Klaus Düsing: »Der Widerspruch ist die Regel des Wahren, er ist nicht der Widerspruch des Falschen« (in: ders., Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik, S. 97).
“Hier in dieser Schrift nun werden die Bilder der Religion weder zu Gedanken – wenigstens nicht in dem Sinne der spekulativen Religionsphilosophie – noch zu Sachen gemacht, sondern als Bilder betrachtet – d.h. die Theologie wird weder als eine mystische Pragmatologie wie von der christlichen Mythologie noch als Ontologie wie von der spekulativen Religionsphilosophie, sondern als psychische Pathologie behandelt. [...] Wie der Mensch denkt, wie er gesinnt ist, so ist sein Gott: soviel Wert der Mensch hat, soviel Wert und nicht mehr hat sein Gott. Das Bewußtsein Gottes ist das Selbstbewußtsein des Menschen, die Erkenntnis Gottes die Selbsterkenntnis des Menschen. Aus seinem Gotte erkennst du den Menschen und wiederum aus dem Menschen seinen Gott; beides ist eins. Was dem Menschen Gott ist, das ist sein Geist, seine Seele, und was des Menschen Geist, seine Seele, sein Herz, das ist sein Gott: Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochne Selbst des Menschen; die Religion die feierliche Enthüllung der verborgnen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse.“ Ludwig Feuerbach - Das Wesen des Christentums
“Die Entwicklung eines Begriffs oder Begriffsverhältnisses (Positiv und Negativ, Ursache und Wirkung, Substanz und Akzidenz) in der Geschichte des Denkens verhält sich zu seiner Entwicklung im Kopf des einzelnen Dialektikers wie die Entwicklung eines Organismus in der Paläontologie zu seiner Entwicklung in der Embryologie (oder vielmehr in der Geschichte und im einzelnen Keim). Daß dies so ist, zuerst von Hegel für die Begriffe entdeckt. in der geschichtlichen Entwicklung spielt die Zufälligkeit ihre Rolle, die im dialektischen Denken wie in der Entwicklung des Embryos sich in Notwendigkeit zusammenfaßt. [...] Verstand und Vernunft. Diese Hegelsche Unterscheidung, in der nur das dialektische Denken vernünftig, hat einen gewissen Sinn. Alle Verstandstätigkeit: Induzieren, Deduzieren, also auch Abstrahieren (Didos Gattungsbegriffe: Vierfüßler und Zweifüßler)Analysieren unbekannter Gegenstände (schon das Zerbrechen einer Nuß ist Anfang der Analyse), Synthesieren (bei tierischen Schlauheitsstückchen) und, als Vereinigung beider, Experimentieren (bei neuen Hindernissen und in fremden Lagen) haben wir mit dem Tier gemein. Der Art nach sind diese sämtlichen Verfahrungsweisen – also alle Mittel der wissenschaftlichen Forschung, die die ordinäre Logik anerkennt – vollkommen gleich beim Menschen und den höheren Tieren. Nur dem Grade (der Entwicklung der jedesmaligen Methode) nach sind sie verschieden. Die Grundzüge der Methode sind gleich und führen zu gleichen Resultaten bei Mensch und Tier, solange beide bloß mit diesen elementaren Methoden arbeiten oder auskommen. – Dagegen das dialektische Denken – eben weil es die Untersuchung der Natur der Begriffe selbst zur Voraussetzung hat – ist nur dem Menschen möglich, und auch diesem erst auf einer verhältnismäßig hohen Entwicklungsstufe (Buddhisten und Griechen) und erreicht seine volle Entwicklung noch viel später durch die moderne Philosophie – und trotzdem schon die kolossalen Resultate bei den Griechen, die die Untersuchung weit antizipieren! Die Chemie, in der die Analyse die vorherrschende Untersuchungsform ist, ist nichts ohne ihren Gegenpol, die Synthese. [...] Über die Klassifikation des Urteils. Die dialektische Logik, im Gegensatz zur alten, bloß formellen, begnügt sich nicht wie diese, die Formen der Bewegung des Denkens, d.h. die verschiednen Urteils-und Schlußformen, aufzuzählen und zusammenhangslos nebeneinander zu stellen. Sie leitet im Gegenteil diese Formen die eine aus der andern ab, sie subordiniert sie einander statt sie zu koordinieren, sie entwickelt die höheren Formen aus den niederen. Getreu seiner Einteilung der ganzen Logik gruppiert Hegel die Urteile als. 1. Urteil des Daseins, die einfachste Form des Urteils, worin von einem einzelnen Ding eine allgemeine Eigenschaft bejahend oder verneinend ausgesagt wird (positives Urteil: Die Rose ist rot; negatives: Die Rose ist nicht blau; unendliches: Die Rose ist kein Kamel); 2. Urteil der Reflexion, worin vom Subjekt eine Verhältnisbestimmung, eine Relation ausgesagt wird (singuläres Urteil: Dieser Mensch ist sterblich; partikuläres: Einige, viele Menschen sind sterblich; universelles: Alle Menschen sind, oder der Mensch ist sterblich); 3. Urteil der Notwendigkeit, worin vom Subjekt seine substantielle Bestimmtheit ausgesagt wird (kategorisches Urteil: Die Rose ist eine Pflanze; hypothetisches Urteil: Wenn die Sonne aufgeht, so ist es Tag; disjunktives: Der Lepidosiren ist entweder ein Fisch oder ein Amphibium); 4. Urteil des Begriffs, worin vom Subjekt aus gesagt wird, inwieweit es seiner allgemeinen Natur oder, wie Hegel sagt, seinem Begriff entspricht (assertorisches Urteil: Dies Haus ist schlecht; problematisches: Wenn ein Haus so und so beschaffen ist, so ist es gut; apodiktisches: Das Haus, so und so beschaffen, ist gut). 1. Einzelnes Urteil, 2. und 3. besondres, 4. allgemeines. So trocken sich dies hier auch liest, und so willkürlich auch auf den ersten Blick diese Klassifikation der Urteile hie und da erscheinen mag, so wird doch die innere Wahrheit und Notwendigkeit dieser Gruppierung jedem einleuchtend werden, der die geniale Entwicklung in Hegels »Großer Logik« (Werke, V, S. 63-115) durchstudiert. Wie sehr aber diese Gruppierung in den Denkgesetzen nicht nur, sondern auch in den Naturgesetzen begründet ist, dafür wollen wir hier ein außer diesem Zusammenhang sehr bekanntes Beispiel anführen. Daß Reibung Wärme erzeugt, wußten schon die vorgeschichtlichen Menschen praktisch, als sie das Reibfeuer, vielleicht schon vor 100000 Jahren, erfanden und noch früher kalte Körperteile durch Reibung erwärmten. Aber von da bis zur Entdeckung, daß Reibung überhaupt eine Wärmequelle ist, sind wer weiß wieviel Jahrtausende vergangen. Genug, die Zeit kam, wo das menschliche Gehirn sich hinreichend entwickelt hatte, um das Urteil fällen zu können: Die Reibung ist eine Quelle von Wärme, ein Urteil des Daseins, und zwar ein positives. Wieder vergingen Jahrtausende, bis 1842 Mayer, Joule und Colding diesen Spezialvorgang nach seinen Beziehungen zu inzwischen entdeckten andern Vorgängen ähnlicher Art, d.h. nach seinen nächsten allgemeinen Bedingungen untersuchten und das Urteil dahin formulierten: Alle mechanische Bewegung ist fähig, sich vermittelst der Reibung in Wärme umzusetzen. So viel Zeit und eine enorme Menge empirischer Kenntnisse waren erforderlich, bis wir in der Erkenntnis des Gegenstands von obigem positiven Urteil des Daseins zu diesem universellen Urteil der Reflexion fortrücken konnten. Jetzt aber ging’s rasch. Schon drei Jahre später konnte Mayer, wenigstens der Sache nach, das Urteil der Reflexion auf die Stufe erheben, auf der es jetzt Geltung hat: Jede Form der Bewegung ist ebenso befähigt wie genötigt, unter den für jeden Fall bestimmten Bedingungen, direkt oder indirekt, in jede andre Form der Bewegung umzuschlagen – Urteil des Begriffs, und zwar apodiktisches, höchste Form des Urteils überhaupt. Was also bei Hegel als eine Entwicklung der Denkform des Urteils als solches erscheint, tritt uns hier entgegen als Entwicklung unsrer auf empirischer Grundlage beruhenden theoretischen Kenntnisse von der Natur der Bewegung überhaupt. Das zeigt denn doch, daß Denkgesetze und Naturgesetze notwendig miteinander stimmen, sobald sie nur richtig erkannt sind. Wir können das erste Urteil fassen als das der Einzelheit: Das vereinzelte Faktum, daß Reibung Wärme erzeugt, wird registriert. Das zweite Urteil als das der Besonderheit: Eine besondre Form der Bewegung, die mechanische, hat die Eigenschaft gezeigt, unter besondern Umständen (durch Reibung) in eine andre besondre Bewegungsform, die Wärme, überzugehn. Das dritte Urteil ist das der Allgemeinheit: Jede Form der Bewegung hat sich erwiesen als befähigt und genötigt, in jede andre Form der Bewegung umzuschlagen. Mit dieser Form hat das Gesetz seinen letzten Ausdruck erlangt. Wir können durch neue Entdeckungen ihm neue Belege, neuen, reicheren Inhalt geben. Aber dem Gesetz selbst, wie es da ausgesprochen, können wir nichts mehr hinzufügen. In seiner Allgemeinheit, in der Form und Inhalt beide gleich allgemein, ist es keiner Erweiterung fähig: Es ist absolutes Naturgesetz. [...] Durch Induktion gefunden vor 100 Jahren, daß Krebse und Spinnen Insekten und alle niedern Tiere Würmer waren. Durch Induktion jetzt gefunden, daß dies Unsinn, und x Klassen bestehn. Worin also der Vorzug des sog. Induktionsschlusses, der ebenso falsch sein kann als der sog. Deduktionsschluß, dessen Grund doch die Klassifikation? Induktion kann nie beweisen, daß es nicht einmal ein Säugetier geben wird ohne Milchdrüsen. Früher die Zitzen Zeichen des Säugetiers. Aber das Schnabeltier hat keine. Der ganze Induktionsschwindel [geht aus] von den Engländern, Whewell, inductive sciences die bloß mathematischen [Wissenschaften] umfassend, und so der Gegensatz gegen Deduktion erfunden. Davon weiß die Logik, alte und neue, nichts. Experimentell und auf Erfahrung beruhend sind alle Schlußformen, die vom Einzelnen anfangen, ja der Induktive Schluß fängt sogar vom A-E- B (allgemein) an. Auch bezeichnend für die Denkkraft unsrer Naturforscher, daß Haeckel fanatisch für die Induktion auftritt grade im Moment, wo die Resultate der Induktion – die Klassifikationen – überall in Frage gestellt (Limulus eine Spinne, Aszidia ein Wirbeltier oder Chordatum, die Dipnoi entgegen aller ursprünglichen Definition der Amphibien dennoch Fische ) und täglich neue Tatsachen entdeckt, die die ganze bisherige Induktionsklassifikation umwerfen. Wie schöne Bestätigung von Hegels Satz, daß der Induktionsschluß wesentlich ein problematischer! Ja, sogar die ganze Klassifikation der Organismen ist durch die Entwicklungstheorie der Induktion abgenommen und auf die »Deduktion«, die Abstammung zurückgeführt – eine Art wörtlich von einer andern durch Abstammung deduziert – und die Entwicklungstheorie durch bloße Induktion nachzuweisen unmöglich, da sie ganz antiinduktiv. Die Begriffe, womit die Induktion hantiert: Art, Gattung, Klasse, durch die Entwicklungstheorie flüssig gemacht und damit relativ geworden: mit relativen Begriffen aber nicht zu induzieren. [...] Die Empirie der Beobachtung allein kann nie die Notwendigkeit genügend beweisen. Post hoc, aber nicht propter hoc (»Enz[yklopädie] «, I, S. 84). Dies ist so sehr richtig, daß aus dem steten Aufgehn der Sonne des Morgens nicht folgt, sie werde morgen wieder aufgehn, und in der Tat wissen wir jetzt, daß ein Moment kommen wird, wo die Sonne eines Morgens nicht aufgeht. Aber der Beweis der Notwendigkeit liegt in der menschlichen Tätigkeit, im Experiment, in der Arbeit: Wenn ich das post hoc machen kann, wird es identisch mit dem propter hoc. [...] Kausalität. Das erste, was uns bei der Betrachtung der sich bewegenden Materie auffällt, ist der Zusammenhang der Einzelbewegungen einzelner Körper unter sich, ihr Bedingtsein durch einander. Wir finden aber nicht nur, daß auf eine gewisse Bewegung eine andre folgt, sondern wir finden auch, daß wir eine bestimmte Bewegung hervorbringen können, indem wir die Bedingungen herstellen, unter denen sie in der Natur vorgeht, ja daß wir Bewegungen hervorbringen können, die in der Natur gar nicht vorkommen (Industrie), wenigstens nicht in dieser Weise, und daß wir diesen Bewegungen eine vorher bestimmte Richtung und Ausdehnung geben können. Hierdurch, durch die Tätigkeit des Menschen, begründet sich die Vorstellung von Kausalität, die Vorstellung, daß eine Bewegung die Ursache einer andern ist. Die regelmäßige Aufeinanderfolge gewisser Naturphänomene allein kann zwar die Vorstellung der Kausalität erzeugen: die Wärme und das Licht, die mit der Sonne kommen; aber hierin liegt kein Beweis, und sofern hätte der Humesche Skeptizismus recht, zu sagen, daß das regelmäßige post hoc nie ein propter hoc begründen könne. Aber die Tätigkeit des Menschen macht die Probe auf die Kausalität. Wenn wir mit [einem] Brennspiegel die Sonnenstrahlen ebenso in einen Fokus konzentrieren und wirksam machen wie die des gewöhnlichen Feuers, so beweisen wir dadurch, daß die Wärme von der Sonne kommt. Wenn wir in eine Flinte Zündung, Sprengladung und Geschoß einbringen und dann abfeuern, so rechnen wir auf den erfahrungsmäßig im vorausbekannten Effekt, weil wir den ganzen Prozeß der Entzündung, Verbrennung, Explosion durch die plötzliche Verwandlung in Gas, Druck des Gases auf das Geschoß in allen seinen Einzelheiten verfolgen können. Und hier kann der Skeptiker nicht einmal sagen, daß aus der bisherigen Erfahrung nicht folge, es werde das nächste Mal ebenso sein. Denn es kommt in der Tat vor, daß es zuweilen nicht ebenso ist, daß die Zündung oder das Pulver versagt, daß der Flintenlauf springt etc. Aber grade dies beweist die Kausalität, statt sie umzustoßen, weil wir für jede solche Abweichung von der Regel bei gehörigem Nachforschen die Ursache auffinden können: chemische Zersetzung der Zündung, Nässe etc. des Pulvers, Schadhaftigkeit des Laufs etc., so daß hier die Probe auf die Kausalität sozusagen doppelt gemacht ist. Naturwissenschaft wie Philosophie haben den Einfluß der Tätigkeit des Menschen auf sein Denken bisher ganz vernachlässigt, sie kennen nur Natur einerseits, Gedanken andrerseits. Aber grade die Veränderung der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen Denkens, und im Verhältnis, wie der Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältnis wuchs seine Intelligenz. Die naturalistische Auffassung der Geschichte, wie z.B. mehr oder weniger bei Draper und andern Naturforschern, als ob die Natur ausschließlich auf den Menschen wirke, die Naturbedingungen überall seine geschichtliche Entwicklung ausschließlich bedingten, ist daher einseitig und vergißt, daß der Mensch auch auf die Natur zurückwirkt, sie verändert, sich neue Existenzbedingungen schafft. Von der »Natur« Deutschlands zur Zeit, als die Germanen einwanderten, ist verdammt wenig übrig. Erdoberfläche, Klima, Vegetation, Fauna, die Menschen selbst haben sich unendlich verändert und alles durch menschliche Tätigkeit, während die Veränderungen, die ohne menschliches Zutun in dieser Zeit in der Natur Deutschlands, unberechenbar klein sind.“ - Friedrich Engels Dialektik der Natur
Allgemeine Fragen der Dialektik🌀👻🌀 “Die Dialektik, die sog. objektive, herrscht in der ganzen Natur, und die sog. subjektive Dialektik, das dialektische Denken, ist nur Reflex der in der Natur sich überall geltend machenden Bewegung in Gegensätzen, die durch ihren fortwährenden Widerstreit und ihr schließliches Aufgehen ineinander, resp. in höhere Formen, eben das Leben der Natur bedingen. Attraktion und Repulsion. Beim Magnetismus fängt die Polarität an, sie zeigt sich an ein und demselben Körper; bei der Elektrizität verteilt sie sich auf 2 oder mehr, die in gegenseitige Spannung geraten. Alle chemischen Prozesse reduzieren sich auf Vorgänge der chemischen Attraktion und Repulsion. Endlich im organischen Leben ist die Bildung des Zellenkerns ebenfalls als eine Polarisierung des lebendigen Eiweißstoffs zu betrachten, und von der einfachen Zelle anweist die Entwicklungstheorie nach, wie jeder Fortschritt bis zur kompliziertesten Pflanze einerseits, bis zum Menschen andrerseits, durch den fortwährenden Widerstreit von Vererbung und Anpassung bewirkt wird. Es zeigt sich dabei, wie wenig Kategorien wie »positiv« und »negativ« auf solche Entwicklungsformen anwendbar sind. Man kann die Vererbung als die positive, erhaltende Seite, die Anpassung als die negative, das Ererbte fortwährend zerstörende Seite, aber ebensogut die Anpassung als die schöpferische, aktive, positive, die Vererbung als die widerstrebende, passive, negative Tätigkeit auffassen. Wie aber in der Geschichte der Fortschritt als Negation des Bestehenden auftritt, so wird auch hieraus rein praktischen Gründen – die Anpassung besser als negative Tätigkeit gefaßt. In der Geschichte tritt die Bewegung in Gegensätzen erst recht hervor in allen kritischen Epochen der leitenden Völker. In solchen Momenten hat ein Volk nur die Wahl zwischen zwei Hörnern eines Dilemmas: entweder – oder!, und zwar ist die Frage immer ganz anders gestellt, als das politisierende Philisterium aller Zeiten sie gestellt wünscht. Selbst der liberale deutsche Philister von 1848 fand sich 1849 plötzlich und unerwartet und wider Willen vor die Frage gestellt: Rückkehr zur alten Reaktion in verschärfter Form, oder Fortgang der Revolution bis zur Republik, vielleicht gar der einen und unteilbaren mit sozialistischem Hintergrund. Er besann sich nicht lange und half die Manteuffelsche Reaktion als Blüte des deutschen Liberalismus schaffen. Ebenso 1851 der französische Bourgeois vor dem von ihm sicher nicht erwarteten Dilemma: Karikatur des Kaisertums, Prätorianertum und Ausbeutung Frankreichs durch eine Lumpenbande, oder sozialdemokratische Republik – und er duckte sich vor der Lumpenbande, um unter ihrem Schutz die Arbeiter fortausbeuten zu können. [...] Hard and fast lines mit der Entwicklungstheorie unverträglich – sogar die Grenzlinie zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen schon nicht mehr fest, ebensowenig die zwischen Fischen und Amphibien, und die zwischen Vögeln und Reptilien verschwindet täglich mehr und mehr. Zwischen Compsognathus und Archaeopteryx fehlen nur noch wenige Mittelglieder, und gezahnte Vogelschnäbel tauchen in beiden Hemisphären auf. Das Entweder dies – oder das! wird mehr und mehr ungenügend. Bei den niedern Tieren der Begriff des Individuums gar nicht scharf festzustellen. Nicht nur, ob dies Tier ein Individuum oder eine Kolonie ist, sondern auch, wo in der Entwicklung Ein Individuum aufhört und das andre anfängt (Ammen). – Für eine solche Stufe der Naturanschauung, wo alle Unterschiede in Mittelstufen zusammenfließen, alle Gegensätze durch Zwischenglieder ineinander übergeführt werden, reicht die alte metaphysische Denkmethode nicht mehr aus. Die Dialektik, die ebenso keine hard and fast lines, kein unbedingtes allgültiges Entweder-Oder! kennt, die die fixen metaphysischen Unterschiede ineinander überführt und neben dem Entweder-Oder! ebenfalls das Sowohl dies – wie jenes! an richtiger Stelle kennt und die Gegensätze vermittelt, ist die einzige ihr in höchster Instanz angemeßne Denkmethode. Für den Alltagsgebrauch, den wissenschaftlichen Kleinhandel, behalten die metaphysischen Kategorien ja ihre Gültigkeit. [...] Identität – abstrakte, a = a; und negativ, a nicht gleich und ungleich a gleichzeitig – ebenfalls in der organischen Natur unanwendbar. Die Pflanze, das Tier, jede Zelle in jedem Augenblick seines Lebens identisch mit sich und doch sich von sich selbst unterscheidend, durch Aufnahme und Ausscheidung von Stoffen, Atmung, durch Zellenbildung und Zellenabsterben, durch den vorgehenden Zirkulationsprozeß, kurz, durch eine Summe unaufhörlicher molekularer Veränderungen, die das Leben ausmachen und deren summierte Resultate in den Lebensphasen – Embryonalleben, Jugend, Geschlechtsreife, Gattungsprozeß, Alter, Tod – augenscheinlich hervortreten. Je weiter die Physiologie sich entwickelt, desto wichtiger werden für sie diese unaufhörlichen, unendlich kleinen Veränderungen, desto wichtiger für sie also ebenso die Betrachtung des Unterschieds innerhalb der Identität, und der alte abstrakt formelle Identitätsstandpunkt, daß ein organisches Wesen als ein mit sich einfach Identisches, Konstantes zu behandeln, veraltet. Trotzdem dauert die auf ihn gegründete Denkweise mit ihren Kategorien fort. Aber schon in der unorganischen Natur die Identität als solche in Wirklichkeit nicht existierend. Jeder Körper ist fortwährend mechanischen, physikalischen, chemischen Einwirkungen ausgesetzt, die stets an ihm ändern, seine Identität modifizieren. Nur in der Mathematik – einer abstrakten Wissenschaft, die sich mit Gedankendingen beschäftigt, gleichviel ob Abklatschen der Realität – ist die abstrakte Identität und ihr Gegensatz gegen den Unterschied am Platz und wird auch da fortwährend aufgehoben. Hegel »Enzykl[opädie]«, I, [S.] 235. Die Tatsache, daß die Identität den Unterschied in sich enthält, ausgesprochen in jedem Satz, wo das Prädikat vom Subjekt notwendig verschieden: Die Lilie ist eine Pflanze, die Rose ist rot, wo entweder im Subjekt oder im Prädikat etwas, das vom Prädikat oder Subjekt nicht gedeckt wird. Hegel, [S.] 231. – Daß die Identität mit sich von vornherein den Unterschied von allem andern zur Ergänzung nötig hat, ist selbstredend. [...] Der Satz der Identität im altmetaphysischen Sinn der Fundamentalsatz der alten Anschauung: a = a. Jedes Ding ist sich selbst gleich. Alles war permanent, Sonnensystem, Sterne, Organismen. Dieser Satz ist von der Naturforschung in jedem einzelnen Fall Stück für Stück widerlegt, theoretisch hält er aber noch vor und wird von den Anhängern des Alten immer noch dem Neuen entgegengehalten: Ein Ding kann nicht gleichzeitig es selbst und ein anderes sein. Und doch ist die Tatsache, daß die wahre konkrete Identität den Unterschied, die Veränderung in sich schließt, von der Naturforschung neuerdings im Detail nachgewiesen (siehe oben). – Die abstrakte Identität, wie alle metaphysischen Kategorien, reicht aus für den Hausgebrauch, wo kleine Verhältnisse oder kurze Zeiträume in Betracht kommen; die Grenzen, innerhalb deren sie brauchbar, sind fast für jeden Fall verschieden und durch die Natur des Gegenstands bedingt – in einem Planetensystem, wobei für die ordinäre astronomische Rechnung die Ellipse als Grundform angenommen werden kann, ohne praktisch Fehler zu machen, viel weiter als bei einem Insekt, das seine Metamorphose in einigen Wochen vollendet. (Andre Beispiele zu geben, z.B. Artenveränderung, die nach einer Reihe von Jahrtausenden zählen.) Aber für die zusammenfassende Naturwissenschaft, selbst in jeder einzelnen Branche, ist die abstrakte Identität total unzureichend, und obwohl im ganzen und großen jetzt praktisch beseitigt, beherrscht sie theoretisch noch immer die Köpfe, und die meisten Naturforscher stellen sich vor, Identität und Unterschied seien unversöhnliche Gegensätze, statt einseitige Pole, die nur in ihrer Wechselwirkung, in der Einfassung des Unterschieds in die Identität, Wahrheit haben. [...] Zufälligkeit und Notwendigkeit Ein andrer Gegensatz, in dem die Metaphysik befangen ist, ist der von Zufälligkeit und Notwendigkeit. Was kann sich schärfer widersprechen als diese beiden Denkbestimmungen? Wie ist es möglich, daß beide identisch seien, daß das Zufällige notwendig und das Notwendige ebenfalls zufällig sei? Der gemeine Menschenverstand und mit ihm die große Menge der Naturforscher behandelt Notwendigkeit und Zufälligkeit als Bestimmungen, die einander ein für allemal ausschließen. Ein Ding, ein Verhältnis, ein Vorgang ist entweder zufällig oder notwendig, aber nicht beides. Beide bestehn also nebeneinander in der Natur; diese enthält allerlei Gegenstände und Vorgänge, von denen die einen zufällig, die andern notwendig sind und wobei es nur darauf ankommt, die beiden Sorten nicht miteinander zu verwechseln. Man nimmt so z.B. die entscheidenden Artmerkmale als notwendig an und bezeichnet sonstige Verschiedenheiten der Individuen derselben Art als zufällig, und dies gilt von Kristallen wie von Pflanzen und Tieren. Dabei wird dann wieder die niedere Gruppe zufällig gegen die höhere, so daß man es für zufällig erklärt, wieviel verschiedne Spezies des Genus felis oder equus oder wieviel Genera und Ordnungen in einer Klasse, und wieviel Individuen von jeder dieser Spezies existieren, oder wieviel verschiedne Arten von Tieren in einem bestimmten Gebiet vorkommen, oder wie überhaupt Fauna, Flora. Und dann erklärt man das Notwendige für das einzig wissenschaftlich Interessierende und das Zufällige für das der Wissenschaft Gleichgültige. Das heißt: Was man unter Gesetze bringen kann, was man also kennt, ist interessant, das, was man nicht unter Gesetze bringen kann, was man also nicht kennt, ist gleichgültig, kann vernachlässigt werden. Damit hört alle Wissenschaft auf, denn sie soll grade das erforschen, was wir nicht kennen. Das heißt: Was man unter allgemeine Gesetze bringen kann, gilt für notwendig, und was nicht, für zufällig. Jedermann sieht, daß dies dieselbe Art Wissenschaft ist, die das, was sie erklären kann, für natürlich ausgibt, und das ihr Unerklärliche auf übernatürliche Ursachen schiebt; ob ich die Ursache des Unerklärlichen Zufall nenne oder Gott, bleibt für die Sache selbst vollständig gleichgültig. Beide sind nur ein Ausdruck für: Ich weiß es nicht, und gehören daher nicht in die Wissenschaft. Diese hört auf, wo der notwendige Zusammenhang versagt. Demgegenüber tritt der Determinismus, der aus dem französischen Materialismus in die Naturwissenschaft übergegangen und der mit der Zufälligkeit fertig zu werden sucht, indem er sie überhaupt ableugnet. Nach dieser Auffassung herrscht in der Natur nur die einfache direkte Notwendigkeit. Daß diese Erbsenschote fünf Erbsen enthält und nicht vier oder sechs, daß der Schwanz dieses Hundes fünf Zoll lang ist und nicht eine Linie länger oder kürzer, daß diese Kleeblüte dies Jahr durch eine Biene befruchtet wurde und jene nicht, und zwar durch diese bestimmte Biene und zu dieser bestimmten Zeit, daß dieser bestimmte verwehte Löwenzahnsamen aufgegangen ist und jener nicht, daß mich vorige Nacht ein Floh um vier Uhr morgens gebissen hat und nicht um drei oder fünf, und zwar auf die rechte Schulter, nicht aber auf die linke Wade, alles das sind Tatsachen, die durch eine unverrückbare Verkettung von Ursache und Wirkung, durch eine unerschütterliche Notwendigkeit hervorgebracht sind, so zwar, daß bereits der Gasball, aus dem das Sonnensystem hervorging, derart angelegt war, daß diese Ereignisse sich so und nicht anders zutragen mußten. Mit dieser Art Notwendigkeit kommen wir auch nicht aus der theologischen Naturauffassung heraus. Ob wir das den ewigen Ratschluß Gottes mit Augustin und Calvin, oder mit den Türken das Kismet, oder aber die Notwendigkeit nennen, bleibt sich ziemlich gleich für die Wissenschaft. Von einer Verfolgung der Ursachenkette ist in keinem dieser Fälle die Rede, wir sind also so klug im einen Falle wie im andern, die sog. Notwendigkeit bleibt eine leere Redensart, und damit – bleibt auch der Zufall, was er war. Solange wir nicht nachweisen können, worauf die Zahl der Erbsen in der Schote beruht, bleibt sie eben zufällig, und mit der Behauptung, daß der Fall bereits in der ursprünglichen Konstitution des Sonnensystems vorgesehn sei, sind wir keinen Schritt weiter. Noch mehr. Die Wissenschaft, welche sich daransetzen sollte, den casus dieser einzelnen Erbsenschote in seiner Kausalverkettung rückwärts zu verfolgen, wäre keine Wissenschaft mehr, sondern pure Spielerei; denn dieselbe Erbsenschote allein hat noch unzählige andre, individuelle, als zufällig erscheinende Eigenschaften, Nuance der Farbe, Dicke und Härte der Schale, Größe der Erbsen, von den durch das Mikroskop zu enthüllenden individuellen Besonderheiten gar nicht zu reden. Die Eine Erbsenschote gäbe also schon mehr Kausalzusammenhänge zu verfolgen, als alle Botaniker der Welt lösen könnten. Die Zufälligkeit ist also hier nicht aus der Notwendigkeit erklärt, die Notwendigkeit ist vielmehr heruntergebracht auf die Erzeugung von bloß Zufälligem. Wenn das Faktum, daß eine bestimmte Erbsenschote sechs Erbsen enthält und nicht fünf oder sieben, auf derselben Ordnung steht, wie das Bewegungsgesetz des Sonnensystems oder das Gesetz der Verwandlung der Energie, dann ist in der Tat nicht die Zufälligkeit in die Notwendigkeit erhoben, sondern die Notwendigkeit degradiert zur Zufälligkeit. Noch mehr. Die Mannigfaltigkeit der auf einem bestimmten Terrain nebeneinander bestehenden organischen und anorganischen Arten und Individuen mag noch so sehr als auf unverbrüchlicher Notwendigkeit begründet behauptet werden, für die einzelnen Arten und Individuen bleibt sie, was sie war, zufällig. Es ist für das einzelne Tier zufällig, wo es geboren ist, welches Medium es zum Leben vorfindet, welche und wie viele Feinde es bedrohen. Es ist für die Mutterpflanze zufällig, wohin der Wind ihren Samen verweht, für die Tochterpflanze, wo das Samenkorn Keimboden findet, dem sie entstammt, und die Versicherung, daß auch hier alles auf unverbrüchlicher Notwendigkeit beruhe, ist ein pauvrer Trost. Die Zusammenwürfelung der Naturgegenstände auf einem bestimmten Gebiet, noch mehr, auf der ganzen Erde, bleibt bei aller Urdetermination von Ewigkeit her doch, was sie war – zufällig. Gegenüber beiden Auffassungen tritt Hegel mit den bisher ganz unerhörten Sätzen, daß das Zufällige einen Grund hat, weil es zufällig ist, und ebensosehr auch keinen Grund hat, weil es zufällig ist; daß das Zufällige notwendig ist, daß die Notwendigkeit sich selbst als Zufälligkeit bestimmt, und daß andrerseits diese Zufälligkeit vielmehr die absolute Notwendigkeit ist (»Logik«, II, Buch III, 2: »Die Wirklichkeit«). Die Naturwissenschaft hat diese Sätze einfach als paradoxe Spielereien, als sich selbst widersprechenden Unsinn links liegenlassen und ist theoretisch verharrt einerseits in der Gedankenlosigkeit der Wolffschen Metaphysik, nach der etwas entweder zufällig ist oder notwendig, aber nicht beides zugleich; oder andrerseits im kaum weniger gedankenlosen mechanischen Determinismus, der den Zufall im allgemeinen in der Phrase wegleugnet, um ihn in der Praxis in jedem besondern Fall anzuerkennen. Während die Naturforschung fortfuhr, so zu denken, was tat sie in der Person Darwins? Darwin, in seinem epochemachenden Werk, geht aus von der breitesten vorgefundnen Grundlage der Zufälligkeit. Es sind grade die unendlichen zufälligen Verschiedenheiten der Individuen innerhalb der einzelnen Arten, Verschiedenheiten, die sich bis zur Durchbrechung des Artcharakters steigern und deren selbst nächste Ursachen nur in den wenigsten Fällen nachweisbar sind, die ihn zwingen, die bisherige Grundlage aller Gesetzmäßigkeit in der Biologie, den Artbegriff in seiner bisherigen metaphysischen Starrheit und Unveränderlichkeit, in Frage zu stellen. Aber ohne den Artbegriff war die ganze Wissenschaft nichts. Alle ihre Zweige hatten den Artbegriff als Grundlage nötig: Die Anatomie des Menschen und die vergleichende – die Embryologie, die Zoologie, Paläontologie, Botanik etc., was waren sie ohne den Artbegriff? Alle ihre Resultate waren nicht nur in Frage gestellt, sondern direkt aufgehoben. Die Zufälligkeit wirft die Notwendigkeit, wie sie bisher aufgefaßt, über den Haufen. Die bisherige Vorstellung von der Notwendigkeit versagt. Sie beizubehalten heißt, die sich selbst und der Wirklichkeit widersprechende Willkürbestimmung des Menschen der Natur als Gesetz aufzudiktieren, heißt damit alle innere Notwendigkeit in der lebenden Natur leugnen, heißt das chaotische Reich des Zufalls allgemein als einziges Gesetz der lebenden Natur proklamieren. »Gilt nichts mehr der Tausves-Jontof!« – schrien die Biologen aller Schulen ganz konsequent. Darwin.“ Friedrich Engels - Fragmente
Zur Reformation: “Die neue Zeit fängt an mit der Rückkehr zu den Griechen. – Negation der Negation! 🌀👻🌀 [...] Die moderne Naturwissenschaft – die einzige, von der qua Wissenschaft die Rede sein kann gegenüber den genialen Intuitionen der Griechen und den sporadisch zusammenhangslosen Untersuchungen der Araber – beginnt mit jener gewaltigen Epoche, die den Feudalismus durch das Bürgertum brach – im Hintergrund des Kampfs zwischen Städtebürgern und Feudaladel die rebellischen Bauern und hinter den Bauern die revolutionären Anfänge des modernen Proletariats, schon die rote Fahne in der Hand und den Kommunismus auf den Lippen, zeigte –, die großen Monarchien in Europa schuf, die geistige Diktatur des Papstes brach, das griechische Altertum wieder heraufbeschwor und mit ihm die höchste Kunstentwicklung der neuen Zeit, die Grenzen des alten Orbis durchbrach und die Erde erst eigentlich entdeckte. Es war die größte Revolution, die die Erde bis dahin erlebt hatte. Auch die Naturwissenschaft lebte und webte in dieser Revolution, war revolutionär durch und durch, ging Hand in Hand mit der erwachenden modernen Philosophie der großen Italiener, und lieferte ihre Märtyrer auf die Scheiterhaufen und in die Gefängnisse. Es ist bezeichnend, daß Protestanten wie Katholiken in ihrer Verfolgung wetteiferten. Die einen verbrannten Servet, die andern Giordano Bruno. Es war eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen hervorbrachte, Riesen an Gelehrsamkeit, Geist und Charakter, die Zeit, die die Franzosen richtig die Renaissance, das protestantische Europa einseitig borniert die der Reformation benannten. Auch die Naturwissenschaft hatte damals ihre Unabhängigkeitserklärung, die freilich nicht gleich im Anfang kam, ebensowenig wie Luther der erste Protestant gewesen. Was auf religiösem Gebiet die Bullenverbrennung Luthers, war auf naturwissenschaftlichem des Kopernikus großes Werk, worin er, schüchtern zwar, nach 36jährigem Zögern und sozusagen auf dem Totenbett, dem kirchlichen Aberglauben den Fehdehandschuh hinwarf. Von da an war die Naturforschung von der Religion wesentlich emanzipiert, obwohl die vollständige Auseinandersetzung aller Details sich noch bis heute hingezogen und in manchen Köpfen noch lange nicht fertig ist. Aber von da an ging auch die Entwicklung der Wissenschaft mit Riesenschritten, sie nahm zu sozusagen im quadratischen Verhältnis der zeitlichen Entfernung von ihrem Ausgangspunkt, gleichsam als ob sie der Welt zeigen wollte, daß für die Bewegung der höchsten Blüte der organischen Materie, den Menschengeist, das umgekehrte Gesetz gelte wie für die Bewegung unorganischer Materie. Die erste Periode der neueren Naturwissenschaft schließt – auf dem Gebiet des Unorganischen – mit Newton ab. Es ist die Periode der Bewältigung des gegebnen Stoffs, und sie hatte im Bereich des Mathematischen, der Mechanik und Astronomie, der Statik und Dynamik, Großes geleistet, besonders durch Kepler und Galilei, aus denen Newton die Schlußfolgerungen zog. Auf dem Gebiete des Organischen aber war man nicht über die ersten Anfänge hinaus. Die Untersuchung der historisch aufeinanderfolgenden und sich verdrängenden Lebensformen sowie die der ihnen entsprechenden wechselnden Lebensbedingungen-Paläontologie und Geologie – existierten noch nicht. Die Natur galt überhaupt nicht für etwas, das sich historisch entwickelt, das seine Geschichte in der Zeit hat; bloß die Ausdehnung im Raum kam in Betracht; nicht nacheinander, nur nebeneinander waren die verschiedenen Formen gruppiert worden; die Naturgeschichte galt für alle Zeiten, wie die Ellipsenbahnen der Planeten. Es fehlten für alle nähere Untersuchung der organischen Gebilde die beiden ersten Grundlagen, die Chemie und die Kenntnis der wesentlichen organischen Struktur, der Zelle. Die anfangs revolutionäre Naturwissenschaft stand vor einer durch und durch konservativen Natur, in der alles noch heute so war wie von Anfang der Welt an, und in der bis zum Ende der Welt alles so bleiben werde, wie es von Anfang an gewesen. Es ist bezeichnend, daß diese konservative Naturanschauung sowohl im Anorganischen wie im Organischen […]“ Friedrich Engels - Fragmente
Über die Dialektik “Aber, wie Marx sagt: »Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen untergeht, verhindert in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken.«“ “Die nachfolgende Arbeit ist keineswegs aus »innerem Antrieb« entstanden. Im Gegenteil wird mir mein Freund Liebknecht bezeugen, wieviel Mühe es ihm gekostet hat, bis er mich bewog, die neueste sozialistische Theorie des Herrn Dühring kritisch zu beleuchten. Einmal dazu entschlossen, hatte ich keine andre Wahl, als diese Theorie, die sich selbst als letzte praktische Frucht eines neuen philosophischen Systems vorführt, im Zusammenhang dieses Systems und damit das System selbst zu untersuchen. Ich war also genötigt, Herrn Dühring auf jenes umfassende Gebiet zu folgen, wo er von allen möglichen Dingen spricht und noch von einigen andern. So entstand eine Reihe von Artikeln, die seit Anfang 1877 im Leipziger »Vorwärts« erschien und hier im Zusammenhang vorliegt. Wenn die Kritik eines trotz aller Selbstanpreisung so höchst unbedeutenden Systems in dieser durch die Sache gebotenen Ausführlichkeit auftritt, so mögen zwei Umstände dies entschuldigen. Einerseits gab mir diese Kritik Gelegenheit, auf verschiedenen Gebieten meine Auffassung von Streitpunkten positiv zu entwickeln, die heute von allgemeinerem wissenschaftlichem oder praktischem Interesse sind. Und so wenig es mir einfallen kann, dem System des Herrn Dühring ein andres System entgegenzusetzen, so wird der Leser hoffentlich auch in den von mir aufgestellten Ansichten, bei aller Verschiedenheit des behandelten Stoffs, den inneren Zusammenhang nicht vermissen. Andrerseits aber ist der »systemschaffende« Herr Dühring keine vereinzelte Erscheinung in der deutschen Gegenwart. Seit einiger Zeit schießen in Deutschland die philosophischen, namentlich die naturphilosophischen Systeme über Nacht zu Dutzenden auf wie die Pilze, von den zahllosen neuen Systemen der Politik, der Ökonomie usw. gar nicht zu sprechen. Wie im modernen Staat vorausgesetzt wird, daß jeder Staatsbürger über alle die Fragen urteilsreif ist, über die abzustimmen er berufen; wie in der Ökonomie angenommen wird, daß jeder Käufer auch ein Kenner aller derjenigen Waren ist, die er zu seinem Lebensunterhalt einzukaufen in den Fall kommt – so soll es jetzt auch in der Wissenschaft gehalten werden. Jeder kann über alles schreiben, und darin besteht grade die »Freiheit der Wissenschaft«, daß man erst recht über das schreibt, was man nicht gelernt hat, und daß man dies für die einzige streng wissenschaftliche Methode ausgibt. Herr Dühring aber ist einer der bezeichnendsten Typen dieser vorlauten Pseudowissenschaft, die sich heutzutage in Deutschland überall in den Vordergrund drängt und alles übertönt mit ihrem dröhnenden – höheren Blech. Höheres Blech in der Poesie, in der Philosophie, in der Ökonomie, in der Geschichtschreibung, höheres Blech auf Katheder und Tribüne, höheres Blech überall, höheres Blech mit dem Anspruch auf Überlegenheit und Gedankentiefe im Unterschied von dem simplen platt-vulgären Blech andrer Nationen, höheres Blech das charakteristischste und massenhafteste Produkt der deutschen intellektuellen Industrie, billig aber schlecht, ganz wie andre deutsche Fabrikate, neben denen es leider in Philadelphia nicht vertreten war. Sogar der deutsche Sozialismus macht neuerdings, namentlich seit dem guten Beispiel des Herrn Dühring, recht erklecklich in höherem Blech; daß die praktische sozialdemokratische Bewegung sich durch dies höhere Blech so wenig irremachen läßt, ist wieder ein Beweis für die merkwürdig gesunde Natur unsrer Arbeiterklasse in einem Lande, wo doch sonst, mit Ausnahme der Naturwissenschaft, augenblicklich so ziemlich alles krankt. Wenn Nägeli in seiner Rede auf der Münchener Naturforscherversammlung sich dahin aussprach, daß das menschliche Erkennen nie den Charakter der Allwissenheit annehmen werde, so sind ihm die Leistungen des Herrn Dühring offenbar unbekannt geblieben. Diese Leistungen haben mich genötigt, ihnen auch auf eine Reihe von Gebieten zu folgen, auf denen ich höchstens in der Eigenschaft eines Dilettanten mich bewegen kann. Es gilt dies namentlich von den verschiednen Zweigen der Naturwissenschaft, wo es bisher häufig für mehr als unbescheiden galt, wenn ein »Laie« ein Wort dareinreden wollte. Indes ermutigt mich einigermaßen der ebenfalls in München gefallene, an einer andern Stelle näher erörterte Ausspruch Herrn Virchows, daß jeder Naturforscher außerhalb seiner eignen Spezialität ebenfalls nur ein Halbwisser, vulgo Laie ist. Wie ein solcher Spezialist sich erlauben darf und erlauben muß, von Zeit zu Zeit auf benachbarte Gebiete überzugreifen, und wie ihm da von den betreffenden Spezialisten Unbehülflichkeit des Ausdrucks und kleine Ungenauigkeiten nachgesehn werden, so habe auch ich mir die Freiheit genommen, Naturvorgänge und Naturgesetze als beweisende Exempel meiner allgemein theoretischen Auffassungen anzuführen, und darf wohl auf dieselbe Nachsicht rechnen. Die Resultate der modernen Naturwissenschaft drängen sich eben einem jeden, der sich mit theoretischen Dingen beschäftigt, mit derselben Unwiderstehlichkeit auf, mit der die heutigen Naturforscher, wollen sie’s oder nicht, zu theoretisch -allgemeinen Folgerungen sich getrieben sehn. Und hier tritt eine gewisse Kompensation ein. Sind die Theoretiker Halbwisser auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, so sind es die heutigen Naturforscher tatsächlich ebensosehr auf dem Gebiet der Theorie, auf dem Gebiet dessen, was bisher als Philosophie bezeichnet wurde. Die empirische Naturforschung hat eine so ungeheure Masse von positivem Erkenntnisstoff angehäuft, daß die Notwendigkeit, ihn auf jedem einzelnen Untersuchungsgebiet systematisch und nach seinem innern Zusammenhang zu ordnen, schlechthin unabweisbar geworden ist. Ebenso unabweisbar wird es, die einzelnen Erkenntnisgebiete unter sich in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Damit aber begibt sich die Naturwissenschaft auf das theoretische Gebiet, und hier versagen die Methoden der Empirie, hier kann nur das theoretische Denken helfen. Das theoretische Denken ist aber nur der Anlage nach eine angeborne Eigenschaft. Diese Anlage muß entwickelt, ausgebildet werden, und für diese Ausbildung gibt es bis jetzt kein andres Mittel als das Studium der bisherigen Philosophie. Das theoretische Denken einer jeden Epoche, also auch das der unsrigen, ist ein historisches Produkt, das zu verschiednen Zeiten sehr verschiedne Form und damit sehr verschiednen Inhalt annimmt. Die Wissenschaft vom Denken ist also, wie jede andre, eine historische Wissenschaft, die Wissenschaft von der geschichtlichen Entwicklung des menschlichen Denkens. Und dies ist auch für die praktische Anwendung des Denkens auf empirische Gebiete von Wichtigkeit. Denn erstens ist die Theorie der Denkgesetze keineswegs eine ein für allemal ausgemachte »ewige Wahrheit«, wie der Philisterverstand sich dies bei dem Wort Logik vorstellt. Die formelle Logik selbst ist seit Aristoteles bis heute das Gebiet heftiger Debatte geblichen. Und die Dialektik gar ist bis jetzt erst von zwei Denkern genauer untersucht worden, von Aristoteles und Hegel. Grade die Dialektik ist aber für die heutige Naturwissenschaft die wichtigste Denkform, weil sie allein das Analogon und damit die Erklärungsmethode bietet für die in der Natur vorkommenden Entwicklungsprozesse, für die Zusammenhänge im ganzen und großen, für die Übergänge von einem Untersuchungsgebiet zum andern. Zweitens aber ist die Bekanntschaft mit dem geschichtlichen Entwicklungsgang des menschlichen Denkens, mit den zu verschiednen Zeiten hervorgetretenen Auffassungen der allgemeinen Zusammenhänge der äußeren Welt auch darum für die theoretische Naturwissenschaft ein Bedürfnis, weil sie einen Maßstab abgibt für die von dieser selbst aufzustellenden Theorien. Der Mangel an Bekanntschaft mit der Geschichte der Philosophie tritt hier aber oft und grell genug hervor. Sätze, die in der Philosophie seit Jahrhunderten aufgestellt, die oft genug längst philosophisch abgetan sind, treten oft genug bei theoretisierenden Naturforschern als funkelneue Weisheit auf und werden sogar eine Zeitlang Mode. Es ist sicher ein großer Erfolg der mechanischen Wärmetheorie, daß sie den Satz von der Erhaltung der Energie mit neuen Belegen gestützt und wieder in den Vordergrund gestellt hat; aber hätte dieser Satz als etwas so absolut Neues auftreten können, wenn die Herren Physiker sich erinnert hätten, daß er schon von Descartes aufgestellt war? Seitdem Physik und Chemie wieder fast ausschließlich mit Molekülen und Atomen hantieren, ist die altgriechische atomistische Philosophie mit Notwendigkeit wieder in den Vordergrund getreten. Aber wie oberflächlich wird sie selbst von den besten unter ihnen behandelt! So erzählt Kekulé (»Ziele und Leistungen der Chemie«), sie rühre von Demokrit her, statt von Leukipp, und behauptet, Dalton habe zuerst die Existenz qualitativ verschiedner Elementaratome angenommen und ihnen zuerst verschiedne, für die verschiednen Elemente charakteristische Gewichte zugeschrieben, während doch bei Diogenes Laertius (X, §§43-44 u. 61) zu lesen ist, daß schon Epikur den Atomen Verschiedenheit nicht nur der Größe und Gestalt, sondern auch des Gewichts zuschreibt, also schon Atomgewicht und Atomvolum in seiner Art kennt. Das Jahr 1848, das in Deutschland sonst mit nichts fertig wurde, hat dort nur auf dem Gebiet der Philosophie eine totale Umkehr zustande gebracht. Indem die Nation sich auf das Praktische warf, hier die Anfänge der großen Industrie und des Schwindels gründete, dort den gewaltigen Aufschwung, den die Naturwissenschaft in Deutschland seitdem genommen, eingeleitet durch die Reiseprediger und Karikaturen Vogt, Büchner etc., sagte sie der im Sande der Berliner Althegelei verlaufenen klassischen deutschen Philosophie entschieden ab. Die Berliner Althegelei hatte das redlich verdient. Aber eine Nation, die auf der Höhe der Wissenschaft stehn will, kann nun einmal ohne theoretisches Denken nicht auskommen. Mit der Hegelei warf man auch die Dialektik über Bord – grade im Augenblick, wo der dialektische Charakter der Naturvorgänge sich unwiderstehlich aufzwang, wo also nur die Dialektik der Naturwissenschaft über den theoretischen Berg helfen konnte – und verfiel damit wieder hülflos der alten Metaphysik. Im Publikum grassierten seitdem einerseits die auf den Philister zugeschnittenen flachen Reflexionen Schopenhauers und später sogar Hartmanns, andrerseits der vulgäre Reiseprediger-Materialismus eines Vogt und Büchner. Auf den Universitäten machten sich die verschiedensten Sorten von Eklektizismus Konkurrenz, die nur darin übereinstimmten, daß sie aus lauter Abfällen vergangner Philosophien zusammengestutzt und alle gleich metaphysisch waren. Von den Resten der klassischen Philosophie rettete sich nur ein gewisser Neukantianismus, dessen letztes Wort das ewig unerkennbare Ding an sich war, also das Stück Kant, das am wenigsten verdiente, aufbewahrt zu werden. Das Endresultat war die jetzt herrschende Zerfahrenheit und Verworrenheit des theoretischen Denkens. Man kann kaum ein theoretisches naturwissenschaftliches Buch zur Hand nehmen, ohne den Eindruck zu bekommen, daß die Naturforscher es selbst fühlen, wie sehr sie von dieser Zerfahrenheit und Verworrenheit beherrscht werden und wie ihnen die jetzt landläufige sog. Philosophie absolut keinen Ausweg bietet. Und hier gibt es nun einmal keinen andern Ausweg, keine Möglichkeit, zur Klarheit zu gelangen, als die Umkehr, in einer oder der andern Form, vom metaphysischen zum dialektischen Denken. Diese Rückkehr kann auf verschiednen Wegen vor sich gehn. Sie kann sich naturwüchsig durchsetzen, durch die bloße Gewalt der naturwissenschaftlichen Entdeckungen selbst, die sich nicht länger in das alte metaphysische Prokrustesbett wollen zwängen lassen. Das ist aber ein langwieriger, schwerfälliger Prozeß, bei dem eine Unmasse überflüssiger Reibung zu überwinden ist. Er ist großenteils schon im Gang, namentlich in der Biologie. Er kann sehr abgekürzt werden, wenn die theoretischen Naturforscher sich mit der dialektischen Philosophie in ihren geschichtlich vorliegenden Gestalten näher beschäftigen wollen. Unter diesen Gestalten sind es namentlich zwei, die für die moderne Naturwissenschaft besonders fruchtbar werden können. Die erste ist die griechische Philosophie. Hier tritt das dialektische Denken noch in naturwüchsiger Einfachheit auf, noch ungestört von den holden Hindernissen, die die Metaphysik des 17. und 18. Jahrhunderts – Bacon und Locke in England, Wolff in Deutschland – sich selbst aufwarf, und womit sie sich den Weg versperrte, vom Verständnis des Einzelnen zum Verständnis des Ganzen, zur Einsicht in den allgemeinen Zusammenhang zu kommen. Bei den Griechen – eben weil sie noch nicht zur Zergliederung, zur Analyse der Natur fortgeschritten waren – wird die Natur noch als Ganzes, im ganzen und großen angeschaut. Der Gesamtzusammenhang der Naturerscheinungen wird nicht im einzelnen nachgewiesen, er ist den Griechen Resultat der unmittelbaren Anschauung. Darin liegt die Unzulänglichkeit der griechischen Philosophie, derentwegen sie später andren Anschauungsweisen hat weichen müssen. Darin liegt aber auch ihre Überlegenheit gegenüber allen ihren späteren metaphysischen Gegnern. Wenn die Metaphysik den Griechen gegenüber im einzelnen recht behielt, so behielten die Griechen gegenüber der Metaphysik recht im ganzen und großen. Dies ist der eine Grund, weshalb wir genötigt werden, in der Philosophie wie auf so vielen andern Gebieten, immer wieder zurückzukehren zu den Leistungen jenes kleinen Volks, dessen universelle Begabung und Betätigung ihm einen Platz in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit gesichert hat, wie kein andres Volk ihn je beanspruchen kann. Der andre Grund aber ist der, daß in den mannigfachen Formen der griechischen Philosophie sich fast alle späteren Anschauungsweisen bereits im Keim, im Entstehen vorfinden. Die theoretische Naturwissenschaft ist daher ebenfalls gezwungen, will sie die Entstehungs-und Entwicklungsgeschichte ihrer heutigen allgemeinen Sätze verfolgen, zurückzugehn auf die Griechen. Und diese Einsicht bricht sich mehr und mehr Bahn. Immer seltner werden die Naturforscher, die, während sie selbst mit Abfällen griechischer Philosophie, z.B. der Atomistik, wie mit ewigen Wahrheiten hantieren, baconistisch-vornehm auf die Griechen herabsehn, weil diese keine empirische Naturwissenschaft hatten. Zu wünschen wäre nur, daß diese Einsicht fortschritte zu einer wirklichen Kenntnisnahme der griechischen Philosophie. Die zweite Gestalt der Dialektik, die grade den deutschen Naturforschern am nächsten liegt, ist die klassische deutsche Philosophie von Kant bis Hegel. Hier ist bereits ein Anfang gemacht, indem auch außerhalb des schon erwähnten Neukantianismus es wieder Mode wird, auf Kant zu rekurrieren. Seitdem man entdeckt hat, daß Kant der Urheber zweier genialer Hypothesen ist, ohne die die heutige theoretische Naturwissenschaft nun einmal nicht vorankommen kann – der früher Laplace zugeschriebnen Theorie von der Entstehung des Sonnensystems und der Theorie von der Hemmung der Erdrotation durch die Flutwelle –, ist Kant bei den Naturforschern wieder zu verdienten Ehren gekommen. Aber bei Kant Dialektik studieren zu wollen, wäre eine nutzlos mühsame und wenig lohnende Arbeit, seitdem ein umfassendes, wenn auch von ganz falschem Ausgangspunkt her entwickeltes Kompendium der Dialektik vorliegt in den Werken Hegels. Nachdem einerseits die durch diesen falschen Ausgangspunkt und durch das hülflose Versumpfen der Berliner Hegelei großenteils gerechtfertigte Reaktion gegen die »Naturphilosophie« ihren freien Lauf gehabt und in bloßes Geschimpfe ausgeartet ist, nachdem andrerseits die Naturwissenschaft in ihren theoretischen Bedürfnissen von der landläufigen eklektischen Metaphysik so glänzend im Stich gelassen worden, wird es wohl möglich sein, vor Naturforschern auch wieder einmal den Namen Hegel auszusprechen, ohne dadurch jenen Veitstanz hervorzurufen, in dem Herr Dühring so Ergötzliches leistet. Vor allem ist festzustellen, daß es sich hier keineswegs handelt um eine Verteidigung des Hegelschen Ausgangspunkts: daß der Geist, der Gedanke, die Idee das Ursprüngliche, und die wirkliche Welt nur der Abklatsch der Idee sei. Dies war schon von Feuerbach aufgegeben. Darüber sind wir alle einig, daß auf jedem wissenschaftlichen Gebiet in Natur wie Geschichte von den gegebenen Tatsachen auszugehn ist, in der Naturwissenschaft also von den verschiednen sachlichen und Bewegungsformen der Materie; daß also auch in der theoretischen Naturwissenschaft die Zusammenhänge nicht in die Tatsachen hineinzukonstruieren, sondern aus ihnen zu entdecken und, wenn entdeckt, erfahrungsmäßig soweit dies möglich nachzuweisen sind. Ebensowenig kann davon die Rede sein, den dogmatischen Inhalt des Hegelschen Systems aufrecht zu halten, wie er von der Berliner Hegelei älterer und jüngerer Linie gepredigt worden. Mit dem idealistischen Ausgangspunkt fällt auch das darauf konstruierte System, also namentlich auch die Hegelsche Naturphilosophie. Es ist aber daran zu erinnern, daß die naturwissenschaftliche Polemik gegen Hegel, soweit sie ihn überhaupt richtig verstanden, sich nur gegen diese beiden Punkte gerichtet hat: den idealistischen Ausgangspunkt und die den Tatsachen gegenüber willkürliche Konstruktion des Systems. Nach Abzug von allem diesem bleibt noch die Hegelsche Dialektik. Es ist das Verdienst von Marx, gegenüber dem »verdrießlichen, anmaßenden und mittelmäßigen Epigonentum, welches jetzt in Deutschland das große Wort führt«, zuerst wieder die vergessene dialektische Methode, ihren Zusammenhang mit der Hegelschen Dialektik wie ihren Unterschied von dieser hervorgehoben und gleichzeitig im »Kapital« diese Methode auf die Tatsachen einer empirischen Wissenschaft, der politischen Ökonomie, angewandt zu haben. Und mit dem Erfolg, daß selbst in Deutschland die neuere ökonomische Schule sich nur dadurch über die vulgäre Freihändlerei erhebt, daß sie Marx abschreibt (oft genug falsch) unter dem Vorwand, ihn zu kritisieren. Bei Hegel herrscht in der Dialektik dieselbe Umkehrung alles wirklichen Zusammenhangs wie in allen andern Verzweigungen seines Systems. Aber, wie Marx sagt: »Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen untergeht, verhindert in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken.« In der Naturwissenschaft selbst aber begegnen uns oft genug Theorien, in denen das wirkliche Verhältnis auf den Kopf gestellt, das Spiegelbild für die Urform genommen ist, und die daher einer solchen Umstülpung bedürfen. Solche Theorien herrschen oft genug für längere Zeit. Wenn die Wärme während fast zwei Jahrhunderten als eine besondre geheimnisvolle Materie galt, statt als eine Bewegungsform der gewöhnlichen Materie, so war das ganz derselbe Fall, und die mechanische Wärmetheorie vollzog die Umstülpung. Nichtsdestoweniger hat die von der Wärmestofftheorie beherrschte Physik eine Reihe höchst wichtiger Gesetze der Wärme entdeckt und besonders durch [J.-B.-J.] Fourier und Sadi Carnot: die Bahn frei gemacht für die richtige Auffassung, die nun ihrerseits die von ihrer Vorgängerin entdeckten Gesetze umzustülpen, in ihre eigne Sprache zu übersetzen hatte. Ebenso hat in der Chemie die phlogistische Theorie durch hundertjährige experimentelle Arbeit erst das Material geliefert, mit Hülfe dessen Lavoisier in dem von Priestley dargestellten Sauerstoff den reellen Gegenpol des phantastischen Phlogiston entdecken und damit die ganze phlogistische Theorie über den Haufen werfen konnte. Damit aber waren die Versuchsresultate der Phlogistik durchaus nicht beseitigt. Im Gegenteil. Sie blieben bestehn, nur ihre Formulierung wurde umgestülpt, aus der phlogistischen Sprache in die nunmehr gültige chemische Sprache übersetzt, und behielten soweit ihre Gültigkeit. Wie die Wärmestofftheorie zur mechanischen Wärmelehre, wie die phlogistische Theorie zu der Lavoisiers, so verhält sich die Hegelsche Dialektik zur rationellen Dialektik.“ Friedrich Engels - Dialektik der Natur
Wenn ein Mensch auf dieser Welt verhungert ohne uns nur das wegzunehmen, was wir ausdrücklich und zuviel haben, d.h., wenn er nicht gegen das Gesetz verstößt und damit nicht zum Dieb, kein Verbrecher wird, um uns lediglich des uns nicht Notwendigen - ihm aber sehr Lebensnotwendigen - zu berauben, dann geschieht uns allen Recht.
“Im Unglück der Wirklichkeit wird der Mensch in sich hineingetrieben und hat da die Einigkeit zu suchen, die in der Welt nicht mehr zu finden ist.“ G.W.F Hegel - Die Geschichte der Philosophie
Quiz