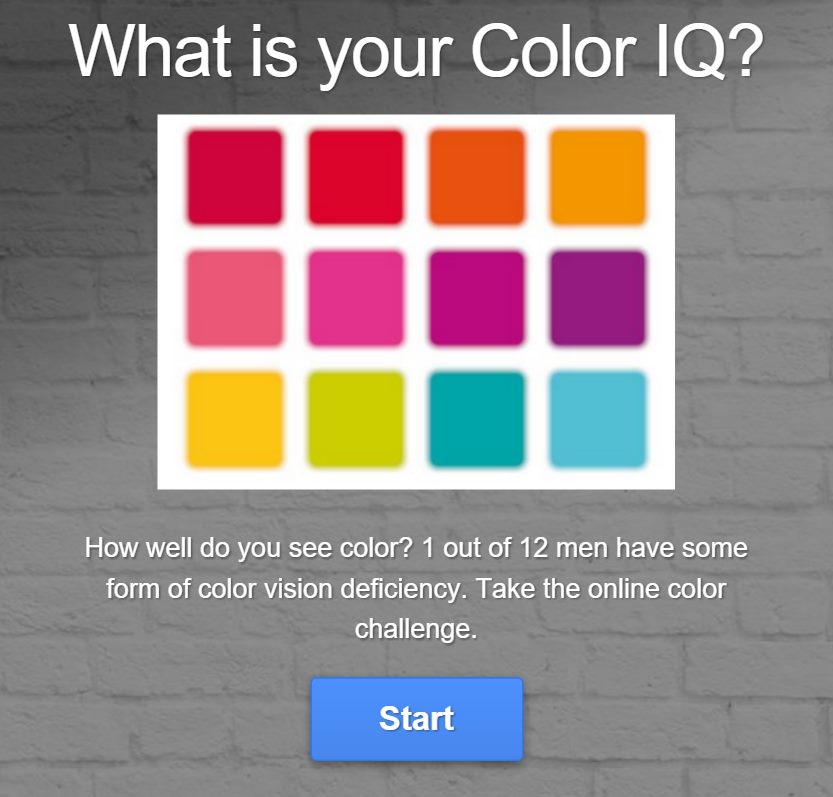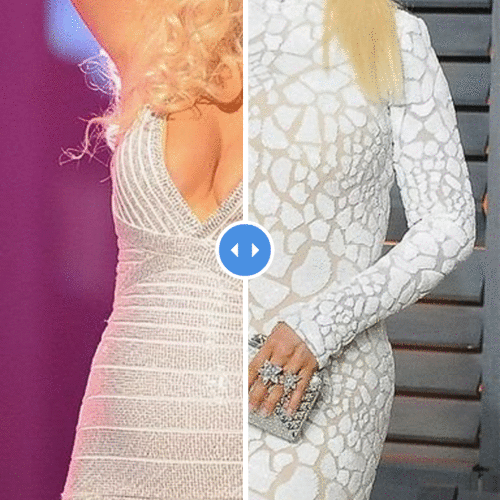Meisterbetrieb Andreas Krumpholz
Description
Wir sind ein mittelständisches Baunternehmen mit bis zu 3 Beschäftigten. Unser Unternehmen existiert seit dem 04.05.09. Im wesentlichen bieten wir drei Leistungsspektren an:
1. Bau-Baunebengewerbe mit Baugutachten, Bauberatung und –controlling, Handwerkervermittlung,
2. Grundstücks und Gebäudeverwaltung mit Hausmeisterdienst, Mieterbetreuung, Lehrstands Betreuung
3. Bürodienstleistungen jeder Art, wie Sekretariat, Firmenverwaltung etc..
Wir stehen aber auch anderen Aufgaben aufgeschlossen gegenüber.
Die Firma Meisterbetrieb Andreas Krumpholz ist in die Handwerksrolle eingetragen.
Wir scheuen uns nicht vor speziellen Aufgaben mit hohem Schwierigkeitsgrad, sondern stellen uns der Herausforderung.
Wir vermitteln Aufträge unserer Kunden, die wir nicht selbst ausführen, an unsere vertraglich gebundenen Handwerksunternehmen und können unseren Kunden eine hohe Qualität und guten Service bieten. Dabei erfolgt die Auftragsanahme und -abwicklung allein durch unser Unternehmen, wir sind damit der einzige Ansprechpartner für den Auftraggeber.
Wir beraten zu kleineren Bauvorhaben und übernehmen hier die Bauleitertätigkeit bzw. das Baucontrolling. Unser Unternehmen bzw. unsere Vertragspartner erstellen Bau- und Bauschadensgutachten.
Wir verstehen uns als Beraterfirma und Dienstleister.
Tell your friends
CONTACT
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.com2016 müssen alle Dächer oder Decken gedämmt sein!
Ratgeber 2016 müssen alle Dächer oder Decken gedämmt sein! Autor: Redaktion Keine Ausnahmen mehr für Altbauen: Ab jetzt müssen die Decken oder die obersten Dachgeschosse aller Häuser energetisch auf der Höhe sein. Mit Jahresbeginn 2016 ging die Bundesregierung einen Schritt weiter, um ihre ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Durch die erhöhten Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) soll der Primärenergie-Bedarf der Häuser um 25 Prozent gesenkt werden. Jetzt erhalten die Häuser ähnlich wie Kühlschränke oder Waschmaschinen ein Effizienz-Label in ihrem Energieausweis. So soll jeder Käufer oder Mieter einfach wie bei „weißer Ware“ unterscheiden können, wie viel Energie das Haus im Durchschnitt verheizt. EnEV 2016: Neue Kessel, verkleidete Rohre, dichte Dächer Für Hausbesitzer und Vermieter heißt die verschärfte Gesetzeslage: Sie müssen investieren. Wer beispielsweise noch einen mehr als 30 Jahre alten Verbrennungs-Heizkessel mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen nutzte, muss ihn spätestens zum Jahresbeginn stillgelegt und ausgewechselt haben. Heizungs- und Warmwasserrohre in unbewohnten Räumen müssen gedämmt sein. Vor allem aber steigt der Gesetzgeber mit seinen neuen Regelungen den Hausbesitzern aufs Dach: Sie müssen das Hausdach oder alternativ dazu die oberste Geschossdecke mit Wärmeschutz einkleiden. Decke oder Dach dürfen einen ganz bestimmten Wärmedurchgangs-Koeffizienten nicht mehr überschreiten: den sogenannten U-Wert von 0,24. Sprich, 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Wann sollte das Dach und wann die Decke gedämmt sein? Ist das Dachgeschoss bewohnt, muss auf jeden Fall das Dach selbst gedämmt werden. Hier reduzieren die Dämmmaterialien nicht nur den Energieverlust. Sie sorgen auch dafür, dass die Dachräume im Winter ohne zusätzliche Klimageräte schön warm und im Sommer angenehm kühl gehalten werden. Bei unbewohnten Dachgeschossen reicht es, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Für den Bauherren ist diese Variante prinzipiell günstiger: Die Geschossdeckendämmung schlägt mit etwa 35 bis 50 Euro pro Quadratmeter für Dämmmatten und gegebenenfalls neue Bodenbeläge zu Buche. Ist jedoch das Dach abzudichten, fallen je nach Dämmart etwa 100 bis 200 Euro Sanierungskosten pro Quadratmeter an. Der Vorteil: die Räume unterm Dach sind dann nicht mehr „kaltgestellt“. Sie können genutzt, vermietet und verkauft werden. Kosten nach kurzer Zeit wieder eingespart Wer nicht dämmt, kann schnell kalte Füße kriegen. Bewusstes Missachten der EnEV wird mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet. Doch was nach Bevormundung klingt, erweist sich mittelfristig als finanzieller Segen. In der Regel amortisieren sich die Investitionen bereits nach vier bis sechs Jahren durch den gesenkten Energieverbrauch. Außerdem deckt die KfW viele der Kosten ab: Die staatliche Bankengruppe springt mit günstigen Darlehen und Fördergeldern ein, wenn die Sanierungsobjekte den KfW-Effizienzhaus-Standards entsprechen. Quelle: https://www.my-hammer.de/artikel/2016-muessen-alle-daecher-oder-decken-gedaemmt-sein.html?utm_source=AG&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=2016_Magazin_KW5&utm_content=Artikel&utm_term=Bauen_2
Energieeffizienzlabel für Heiztechnik: EU-Verordnung bietet Entscheidungshilfe beim Heizungskauf
Hier ein Beitrag unter dem Motto - "Das ändert sich 2016": Energieeffizienzlabel für Heiztechnik: EU-Verordnung bietet Entscheidungshilfe beim Heizungskauf Autor: Redaktion Das bekannte Energielabel ist nun auch für Heizungsanlagen Vorschrift. Hausbesitzer, die eine Heizung kaufen wollen, sollten sich damit vertraut machen. 23 Label-Varianten sind zu unterscheiden Die EU-Energielabel sind den meisten Hausbesitzern vertraut, denn sie sind schon seit Jahren Vorschrift bei Elektrogeräten und Leuchtmitteln. Seit dem 26. September 2015 sind nun auch Energieeffizienzlabel für Heizanlagen und Warmwasserbereiter vorgeschrieben. Da Heizsysteme und Warmwasserbereiter viel größere technische Unterschiede aufweisen als beispielsweise Kühlschränke, ist auch mit dem Produktlabel ein Vergleich schwierig. Dies führte zu derzeit 23 verschiedenen Labeln, die durch zwei verschiedene Verordnungen erfasst sind. Raumheizgeräte, die nur der Raumheizung dienen, Kombiheizgeräte, die auch warmes Wasser bereiten und Verbundanlagen, die diese Geräte mit Temperaturreglern und Solareinrichtungen verknüpfen, erfasst die EU-Verordnung Nr. 811/2013. In der EU-Verordnung Nr. 812/2013 werden Geräte erfasst, die ausschließlich Trink- und Sanitärwasser erwärmen, aber keine Haushaltswasserkocher. Da unterschiedliche Technologien für Wärme sorgen, gibt es derzeit 13 Energieeffizienzlabel. Die restlichen 10 Energielabel kommen erst nach der Verschärfung der Verordnung zum 26. September 2017 (Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher) beziehungsweise 26. September 2019 (Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte) zum Tragen. Die Verordnungen betreffen konventionelle Technologien, also herkömmliche Heizgeräte für Gas, Strom oder Öl. Ferner sind Labels für die Wärmeerzeugung über Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke), Wärmepumpen, Niedertemperatur-Wärmepumpen und Solarthermie geplant. Auch Wasserspeicher mit einer Nennleistung von höchstens 70 kW und mit bis zu 500 Liter Inhalt, benötigen ein Label. Derzeit sind alle Heizsysteme, die feste Brennstoffe und Biomasse verbrennen, nicht in den Verordnungen erfasst. Wer also eine Holzheizung erwerben möchte, sucht das Produktlabel vergeblich. Vergleich der Energieeffizienz ist nicht immer möglich Da in der Verordnung auch festgeschrieben ist, dass die Energieeffizienz bei der jahreszeitenbedingten Raumheizung nicht unter 86% fallen darf, gibt es Heizwertgeräte nicht mehr zu kaufen. Diese erfüllen die Vorschrift nicht. Die Etiketten geben dem Hausbesitzer aber keine Auskunft darüber, wie effizient die Heizung im Allgemeinen ist. Auf keinem der Labels steht, wie viel Prozent des eingesetzten Brennstoffes in nutzbare Wärme umgesetzt wird. Dies erschwert den Vergleich zwischen verschiedenen Heizsystemen. Das Etikett, für die jahreszeitbedingte Raumheizung reicht von der Energieeffizienz A++ bis G. Ein Gerät mit Heizkessel bekommt aber ein anderes Label, als eines mit Kraft-Wärme-Kopplung. Der Hausbesitzer erkennt am Etikett beispielsweise nur, wie eine Heizung mit Kessel im Vergleich zu anderen Wärmererzeugern dieses Systems abschneidet. Er sieht nicht, ob es effizienter ist als ein Blockheizkraftwerk. Letztendlich gibt das Label nur Auskunft darüber, wie effizient eine Heizungsanlage im Vergleich mit anderen Anlagen gleicher Technologie ist. Das Label ist eine große Hilfe innerhalb einer bestimmten Heizungsart, diejenige zu finden, die am wenigsten Brennstoff verbraucht. Es kann aber nicht aus allen möglichen Systemen das beste herausfiltern. Wichtig: Das Label hilft auch nicht bei der Entscheidung Öl oder Gas, denn es berücksichtigt nur den Verbrauch des Brennmaterials, nicht dessen Kosten. Es gibt auch keine Auskunft über die Umweltfreundlichkeit, denn das Ökodesign bleibt unberücksichtigt. Was dem EU-Energielabel zu entnehmen ist Dem Etikett müssen Angaben über Lieferanten, die Modellkennung, die Raumheizungsfunktion sowie die Wärmenennleistung in Kilowatt zu entnehmen sein. Ferner müssen die Hersteller auch die Lautstärke in dB angeben. Im Bezug auf die Lautstärke können Hausbesitzer alle Heizungen über den Eintrag auf dem Etikett einstufen. Je nach Art der Anlage sind weitere Informationen vorgeschrieben. Das Label von Blockheizkraftwerken zeigt an, wie viel Strom es erzeugt und bei Niedertemperatursystemen ist auch der Temperaturbereich ersichtlich. Das Verbundlabel für Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen beispielsweise muss auch über die Möglichkeit der Erweiterungen durch Sonnenkollektoren, Warmwasserspeicher, Temperaturregler sowie ein zusätzliches Raumheizgerät informieren. Fazit – das Label alleine hilft nicht beim Sparen Das Energieeffizienzlabel hilft Heizungsanlagen, die mit dem gleichen Brennstoff betrieben werden und mit der gleichen Technik arbeiten, zu vergleichen. Welche Heizung im konkreten Fall die beste ist, kann nur ein Heizungsfachmann vor Ort entscheiden. Fördermittel gibt es in der Regel immer, wenn eine Heizung modernisiert wird. Quelle: https://www.my-hammer.de/artikel/energieeffizienzlabel-fuer-heiztechnik-eu-verordnung-bietet-entscheidungshilfe-beim/?utm_source=AG&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=2015_Magazin_KW3&utm_content=Artikel&utm_term=Bauen
Meisterbetrieb Andreas Krumpholz
Und nochmal: Neues zu den Folgen einer Schwarzgeldabrede Und nochmal: Neues zu den Folgen einer Schwarzgeldabrede Bereits mehrfach hatten wir Sie im Rahmen dieses Newsletters auf eine geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu den Folgen einer Schwarzgeldabrede hingewiesen. Da war vor einigen Jahren zunächst die Entscheidung, wonach der Unternehmer bei einer Schwarzgeldabrede keinen einklagbaren Anspruch auf Werklohn gegen den Bauherrn hat. Es folgte dann die Entscheidung, wonach in einer solchen Konstellation auch der Bauherr konsequenterweise dann keinerlei Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Unternehmer wegen Mängeln hat. Zuletzt folgte jüngst die Entscheidung des Bundesgerichtshofes, wonach auch bei einer nur teilweisen Schwarzgeldabrede (es sollte also ein Teil der Leistung offiziell berechnet und bezahlt werden und nur ein kleinerer Teil inoffiziell "ohne Rechnung") der Unternehmer insgesamt keinen Anspruch auf Werklohn hat, also auch keinen Anspruch auf den "offiziellen" Teil des Werklohns also den, für den eine Rechnung gestellt wurde. Offen gelassen hat der Bundesgerichtshof sodann in dieser Entscheidung eigentlich drei wesentliche Punkte für die Praxis: Dies ist zunächst einmal die Frage, ob im Hinblick auf diese Entscheidung eine Übertragbarkeit auf die Gewährleistungsansprüche besteht, ob also in dem Fall einer teilweisen Schwarzgeldabrede auch die Gewährleistungsansprüche insgesamt nicht mehr bestehen. Bei der vom Bundesgerichtshof angenommenen Gesamtnichtigkeit des Vertrages wäre dies aber nur konsequent und eine entsprechende Entscheidung steht eigentlich in Zukunft zu erwarten. Zum anderen stellte sich für den Praktiker die Frage, wer denn genau die Schwarzgeldabrede beweisen muss und wie hoch die Darlegungslast an eine entsprechende Vereinbarung ist. Hierzu hat der Bundesgerichtshof sich bis heute nicht ausdrücklich erklärt. Insoweit ist sicherlich demnächst mit einer recht spannenden Entscheidung zu rechnen. Schließlich stellte sich noch die Frage, ob und inwieweit nicht der Unternehmer, der sich auf eine Schwarzgeldabrede einlässt, Gefahr läuft, dass er den bereits gezahlten Werklohn an den Bauherrn zurückerstatten muss. Schließlich war doch der gesamte Vertrag nichtig und ein einklagbarer Anspruch auf den Werklohn bestand nicht. Mit dieser letzten Frage hat der Bundesgerichtshof sich nun jüngst befasst. Mit Urteil vom 11.06.2015 zum Az. VII ZR 216/14 hat der Bundesgerichtshof nun entschieden, dass ein Rückzahlungsanspruch gegen den Unternehmer nicht besteht. Der aufgrund einer Schwarzgeldabrede erhaltene "Werklohn" kann also vom Unternehmer behalten werden. Hierzu bezieht der Bundesgerichtshof sich auf die Vorschrift des § 817 S. 1 BGB der bestimmt, dass der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet ist, wenn der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt war, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. Allerdings schließt Satz 2 Halbsatz 1 dieser Vorschrift die Rückforderung aus, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn der Besteller ohne Rechnung mit Steuerausweis den vereinbarten Betrag bezahlt. Wer bewusst das im Schwarzarbeitsgesetz enthaltene Verbot missachtet, soll nach der Intention des Gesetzgebers schutzlos bleiben und veranlasst werden, das verbotene Geschäft eben gerade nicht abzuschließen. Dieser Beitrag wurde verfasst von Rechtsanwalt Markus Cosler, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehrbeauftragter für Baurecht an der FH Hannover. (Kanzlei Delheid Soiron Hammer, Aachen, www.delheid.de) Quelle: http://www.bauprofessor.de/News/437a6b89-2683-4c05-a354-825d2fd79c5a
MAP 3.0: Update für das Marktanreizprogramm ... und den BDH-Förderleitfaden
noch zur Ergänzung zum Beitrag über die Fördermaßnahmen: MAP 3.0: Update für das Marktanreizprogramm ... und den BDH-Förderleitfaden direkter PDF-Download (18.3.2015; ISH-Bericht) Die Bundesregierung hebt die staatlichen Zuschüsse für das Heizen mit erneuerbaren Energien kräftig an und hat die Eckdaten dazu in der Woche vor der ISH bekannt gegeben. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hatte daraufhin schnell reagiert und konnte bereits zur ISH eine überarbeitete Version seines Leitfadens „Effiziente Heizsysteme mit Geld vom Staat“ vorlegen (direkter PDF-Download). Das seit Jahren etablierte „Marktanreizprogramm“ (MAP) - ein mit über 300 Mio. Euro ausgestattetes Anreizpaket für die Energiewende auf dem Wärmemarkt - wurde neu geschnürt und wartet nun mit erheblich attraktiveren Förderbedingungen auf. Private und gewerbliche Hausbesitzer, die auf moderne Heizungen mit erneuerbaren Energien umstellen wollen, können sich auf deutlich höhere Investitionszuschüsse für Solar-, Biomasse- und Wärmepumpenanlagen freuen. Zudem werden nun begleitende Investitionen in das Heizungssystem gefördert. Öffnung für den gewerblichen Bereich Ein weiterer Schwerpunkt des neuen MAP ist die konsequente Öffnung des Programms für den gewerblichen Bereich: Mit Investitionszuschüssen von bis zu 50% sollen alle Unternehmen sowohl bei Neubauprojekten als auch bei Sanierungsmaßnahmen für die Wärmewende begeistert werden. Ganz neu im Programm: Der Bund gibt nun auch Zuschüsse für die nachträgliche Optimierung bereits geförderter Öko-Heizungen. Beim für die Zuschussbewilligung zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) richtet man sich nun auf ein deutlich höheres Antragsvolumen ein. „Mit der am 1. April 2015 in Kraft tretenden neuen Richtlinie trägt Bundeswirtschaftsminister Gabriel der Bedeutung des Wärmemarktes für das Gelingen der Energiewende Rechnung. Das dringend benötigte Aufbruchssignal ist nun gegeben“, freut sich der Präsident des BAFA, Dr. Arnold Wallraff. BAFA: „Die Energiewende beginnt im Heizungskeller“ Zum Hintergrund: Der in der politischen Diskussion oft vergessene Wärmemarkt spielt für die Energiewende eine gleichermaßen entscheidende Rolle wie der Strommarkt. Heizung und Warmwasser machen 40 Prozent des Energieverbrauchs aus und produzieren ein Drittel der CO₂-Emissionen. Besonders hervorzuheben ist, dass nun auch Großunternehmen antragsberechtigt sind. Damit dringt das MAP in eine ganz neue Dimension vor. Im BAFA spricht man deshalb vom „MAP 3.0“. Nach Dr. Wallraffs Überzeugung unterstreicht die neue Richtlinie die Bedeutung des MAP für die Energiewende. Das MAP versorge den regenerativen Heizungsmarkt mit den notwendigen finanziellen Impulsen und schaffe ein positives Investitions- und Innovationsklima. „Nach dem wiederholten Scheitern der Bemühungen um eine steuerliche Abschreibung von energetischen Sanierungsmaßnahmen erweist sich das runderneuerte MAP als zentrales und verlässliches Instrument der Bundesregierung für die Energiewende im Wärmemarkt“, so der Präsident des BAFA. Gabriel: „neue Maßstäbe für die Heizungsbranche“ Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, versteht die Novelle des Marktanreizprogramms als weiteren wichtigen Schritt zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) und verspricht: „Mit innovativen Elementen, wie beispielsweise der Einführung einer ertragsabhängigen Förderung bei Solarthermie und anspruchsvollen Effizienzkriterien, setzt das MAP neue Maßstäbe für die Heizungsbranche. Über verbesserte Förderanreize wollen wir so den Zubau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt deutlich beschleunigen. Auch wollen wir das Programm für den gewerblichen Bereich stärker öffnen. Denn die Energiewende im Wärmemarkt muss sich künftig noch stärker auch in den Betrieben abspielen. Kleine und mittlere Unternehmen können deshalb vom MAP verstärkt profitieren und erhalten in dem für Unternehmen zugeschnittenen KfW-Teil des Programms einen so genannten KMU-Bonus von 10%. Auch für große Betriebe erweitern wir die Antragsberechtigung sowohl mit Blick auf Investitionszuschüsse als auch für Darlehen und Tilgungszuschüsse.“ Mit einem Volumen von über 300 Mio. Euro pro Jahr soll das Marktanreizprogramm das zentrale Instrument zum Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt sein. Das MAP fördert private, gewerbliche und kommunale Investitionen in Heizungsanlagen oder größere Heizwerke, die erneuerbare Energien nutzen, und in Wärmenetze, die erneuerbar erzeugte Wärme verteilen. Die Förderung unterstützt dabei primär die Errichtung von Anlagen im Gebäudebestand. Im Neubau ist eine Förderung nur bei bestimmten innovativen Anlagentypen möglich. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte hat sich seit 2012 nur noch langsam weiterentwickelt und liegt derzeit bei 9,9%. Die Novelle des MAP sei daher erforderlich, so Gabriel, um das ambitionierte Ziel des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes von 14% Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 zu erreichen. Die novellierte Förderrichtlinie tritt am 1. April 2015 in Kraft. Die nichtamtliche Lesefassung ist über das BMWi abrufbar. Der BDH-Leitfaden „Effiziente Heizsysteme mit Geld vom Staat“ ist unter bdh-koeln.de > Fachleute> Publikationen > Broschüren downloadbar Quelle: http://www.baulinks.de/webplugin/2015/0450.php4
Meisterbetrieb Andreas Krumpholz
Deutlich höhere Fördersätze für Heizungsmodernisierungen (3.1.2016) Am 1. Januar 2016 startete das Bundeswirtschaftsministerium das „Anreizprogramm Energieeffizienz“ (APEE). Ziel ist es u.a., neue Innovations- und Investitionsimpulse für die Wärmewende im Heizungskeller zu setzen. Hierfür stehen im APEE insgesamt 165 Millionen Euro pro Jahr über 3 Jahre für Zinsverbilligungen und Zinszuschüsse zur Verfügung. Mit dem APEE wird die bestehende Förderlandschaft erweitert. Wer im Rahmen des „Heizungspakets“ seine ineffiziente Heizungsanlage durch einen Biomassekessel bzw. eine Wärmepumpe ersetzt oder durch Einbindung einer heizungsunterstützenden Solaranlage seine bestehende Heizung ertüchtigt und sein gesamtes Heizungssystem durch Verbesserung der Energieeffizienz optimiert, erhält einen Zusatzbonus von 20% der Förderung nach dem Marktanreizprogramm (MAP). Weiterhin wird ein einmaliger Investitionszuschuss in Höhe von 600 Euro für notwendige Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz gewährt. Die zu modernisierende bzw. auszutauschende Heizungsanlage muss folgende Kriterien erfüllen: Betrieb auf Basis fossiler Energien (z. B. Gas oder Öl). Keine Nutzung von Brennwerttechnik oder Brennstoffzellen-Technologie. Es liegt kein Fall von gesetzlicher Austauschpflicht nach §10 der Energieeinsparverordnung (EnEV) vor. Bei der Optimierung der gesamten Heizungsanlage müssen folgende Schritte durchgeführt werden: Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes (z.B. nach DIN EN 15378). Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten Heizungssystem - z.B. durch die Optimierung der Heizkurve, die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von Einzelraumreglern. Der Antrag für den Zusatzbonus nach dieser Richtlinie ist im Rahmen des Antragsverfahrens auf Gewährung einer MAP-Förderung zu stellen. Die geeigneten Formulare sollen ab Mitte Januar über die BAFA-Website downloadbar sein. siehe auch für zusätzliche Informationen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) EnergieSparRatgeber Förderratgeber von co2online und Fördermitteldatenbank von fe.bis ausgewählte weitere Meldungen: Worauf Hauseigentümer und Verbraucher 2016 achten müssen (22.12.2015) Zuschüsse für Solarheizungen werden zum 1.1.2016 um 20% erhöht (21.12.2015) Solar-/Heimspeicherprogramm läuft weiter (27.11.2015) EnergieBonusBayern: 90 Millionen Euro für Gebäudesanierungen bis 2018 (15.9.2015) KfW verbessert zum 1.8.2015 ihr Programm „Energieeffizient Sanieren“ (5.7.2015) Sanierung von Häusern aus den Jahren 1995 bis 2001 wird jetzt auch gefördert (7.6.2015) Quelle: http://www.baulinks.de/webplugin/2016/0004.php4
Quiz