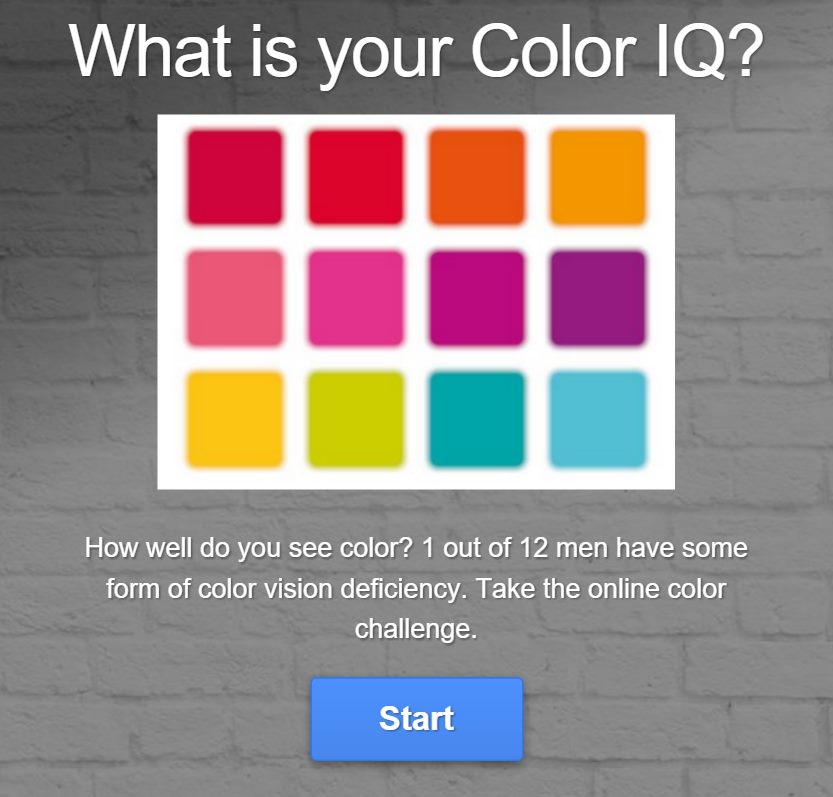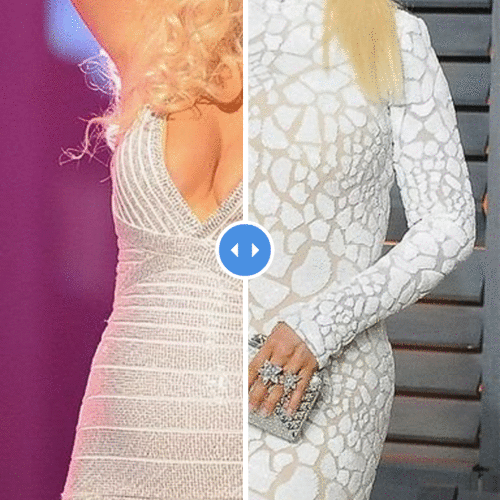Description
Der Lehrstuhl für Politische Wissenschaft II gehört zur Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim. Professor Dr. Thomas König ist seit 2007 der Lehrstuhlinhaber. Impressum: http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol2/
Tell your friends
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.comTimeline Photos
Timeline Photos
HEUTE SONNTAG, 23. APRIL 2017 IN DER FRANKFURTER SONNTAGSZEITUNG Monopolisten der Macht. Erdogan, Orbán & Co. verwandeln offene Demokratien in protektionistische Autokratien. Sie beschneiden Freiheiten und verhindern Wettbewerb. Von Thomas König Am 4. April beschloss das ungarische Parlament auf dem Weg einer eilbedürftigen Sondergesetzgebung, dass die in den Vereinigten Staaten akkreditierte Central European University mit Sitz in Budapest innerhalb von sechs Monaten einen amerikanischen Campus eröffnen muss. Abgesehen von den Kosten, ist diese Forderung unmöglich in der kurzen Zeit zu bewältigen. Die international renommierte Universität, die der ungarische Milliardär George Soros im Jahr 1991 zur Stärkung der Demokratie in Ungarn gegründet hatte, steht damit vor dem Aus. Ihre philanthropische Ausrichtung war dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán schon lange ein Dorn im Auge. Im Jahr 2011 hatte Orbán, der vor einer Sowjetisierung durch die Europäische Union warnt, bereits über ein Mediengesetz die Pressefreiheit in Ungarn eingeschränkt, um zwei Jahre später eine Verfassungsreform zur Beschneidung gerichtlicher Kompetenzen zu verabschieden. Dieses Muster kommt im Werdegang und in den Grundzügen der türkischen Verfassungsreform gleich, die Präsident Recep Tayyip Erdogan am vergangenen Sonntag zur Abstimmung stellte und die vom türkischen Volk, einschließlich der türkischen Gemeinden in Deutschland, die Mehrheit erhielt. Das Grundmuster findet sich nicht nur in Ungarn und der Türkei: Einschränkung der Pressefreiheit, Begrenzung von gerichtlichen Kompetenzen, Regieren per Sondergesetzgebung zur Gleichschaltung von Bildungseinrichtungen und Ausschaltung von Opposition mit anschließender Verfassungsänderung zur Auflösung der demokratischen Gewaltenteilung. Auch in Polen ist seit dem Wahlsieg der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ von Jaroslaw Kaczynski eine Monopolisierung von Macht erkennbar. Die gerichtliche Einstufung von verfassungswidrigen Gesetzen wird von der polnischen Regierung einfach ignoriert, neue regierungskonforme Richter und Medienvertreter werden ernannt, die über kurz oder lang den Kurs der Partei unterstützen werden. Die Reaktionen der Europäischen Union und der Nachbardemokratien auf diese autoritäre Entwicklung fallen dagegen moderat aus. Von einigen Parteien der Nachbarländer werden Viktor Orbán und Jaroslaw Kaczynski sogar hofiert, gegenüber Recep Tayyip Erdogan fallen selbst die Reaktionen diplomatisch aus, wenn dieser für seine Verfassungsreform die türkischen Gemeinden im Ausland aufwiegelt. Aus politökonomischer Sicht wirft dieser Abbau der demokratischen Gewaltenteilung nicht nur Fragen nach den Ursachen, sondern auch nach der Zurückhaltung der Europäischen Union auf, die sich dem Rechtsstaatsprinzip verschrieben hat. Geht man vielleicht davon aus, dass diese Entwicklung eine vorübergehende Erscheinung ist, die sich in kommenden Wahlen erledigen wird? Übt man Zurückhaltung, um diesen Kräften nicht noch Argumente für die Beschwörung eines äußeren Feinds zu geben? Oder existieren womöglich vielerorts ähnliche strukturelle Ursachen und Trends, gegen die – wie das Beispiel Brexit oder die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten – selbst Demokratien mit langer Tradition und etablierten „checks and balances“ nicht gefeit sind? Um diese Fragen einigermaßen systematisch beantworten zu können, empfiehlt sich ein Blick in die Erkenntnisse der (Politik-)Wissenschaft, die grundsätzlich Autokratien von Demokratien hinsichtlich der Machtkonzentration und ihrer Legitimation unterscheidet. Historisch betrachtet gab es vom alten Rom über den Absolutismus bis hin zur Sowjetunion mehr Auto- als Demokratien, in denen die Macht auf eine Person oder eine Personengruppe konzentriert ist. Zur Legitimation dieses Machtmonopols dienten früher traditionale Herkunftsmerkmale wie göttliche oder familiäre Abstammung, die später durch charismatische, eher persönlichkeitsbezogene Eigenschaften wie Führerschaft oder prophetisches Wissen über feindliche Verschwörungen oder äußere Bedrohungen abgelöst wurden. Traditionale und charismatische Herrschaftsformen versprechen die Umsetzung eines einheitlichen Volkswillens, wofür individuelle Freiheiten und Pluralismus gegebenenfalls zu opfern sind. Aus politökonomischer Sicht werben sie für Protektion, um sich und das eher bildungsferne Volk vor äußeren Einflüssen zu schützen. Dagegen geht in Demokratien nicht nur die Macht vom Volk aus, sondern sie wird auf Gewalten verteilt und in einer Art Gesellschaftsvertrag rational über das Rechtsstaatsprinzip legitimiert, das individuelle Freiheiten und pluralistischen Wettbewerb garantiert: Wettbewerb über Gewaltenteilung, Wettbewerb über Wahlen, Wettbewerb über Meinungen, Wettbewerb über Wissen. Deshalb werden die Aufgaben von Exekutive, Legislative und Judikative getrennt, Parteien und Kandidaten mit unterschiedlichen Angeboten aufgestellt, Rundfunk, Zeitungen und andere Medien zur Wahrung der Meinungsvielfalt zugelassen, Schulen und Universitäten zur Vermittlung von Wissen eingerichtet. Legt man ökonomische Kategorien an, dann wird dieser pluralistische Wettbewerb effektiv über Minderheitenschutz und eine Opposition gestaltet, die alternative Angebote, Meinungen und Wissen bereitstellt. Unter Wettbewerbsbedingungen gründen rationale Herrschaftsformen nicht auf einem einheitlichen Volkswillen, sondern auf einem zeitlich befristeten Mandat, das auf der Einhaltung von Versprechen und der Ablösung bei Nichteinhaltung beruht. Aus politökonomischer Sicht treten Demokratien für Offenheit ein, betreiben Handel und führen keine Kriege untereinander. Dass sich Demokratien und Autokratien über die Zeit hinweg wandeln und gelegentlich Mischformen produzieren, ist keine Neuigkeit. Gegenüber der Sowjetunion werden in Wladimir Putins Russland formal Gewalten geteilt, Parteien und Kandidaten aufgestellt, wie es auch Rundfunk, Zeitungen und andere Medien sowie Schulen und Universitäten gibt. Aber der pluralistische Wettbewerb über Angebote, Meinungen und Wissen wird weitestgehend eingeschränkt und über die regierende Partei auf eine Person oder Personengruppe konzentriert, zu deren Protektion die Opposition per Sondergesetzgebung ausgeschaltet und Gewaltenteilung per Verfassungsreform abgeschafft wird. Der Wettbewerb von Medien, Bildungs- und Forschungseinrichtungen wird über öffentliche Mittelvergabe gesteuert und das Führungspersonal auf (Partei-)Linie gebracht. Auf gelegentlich aufkommenden Protest wird unter Hinweis auf ausländische Kräfte in einem Klima reagiert, das von Verschwörungstheorien geprägt ist. Kein Wunder, dass Wladimir Putin in autoritären Demokratien viel Zuspruch erhält. Etwas überraschender ist jedoch der aktuelle Trend von Demokratien in Richtung Autokratie, die sich als Mitglieder oder Beitrittskandidaten der Europäischen Union dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet und in den vergangenen Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. Zuvor hatte es einen gegenläufigen Trend gegeben: Griechenland, Portugal und Spanien gaben ihre autokratischen Herrschaftsformen auf und wurden als Demokratien Mitglieder der Europäischen Union. Die meisten osteuropäischen Staaten schüttelten ihre autokratischen Formen ebenfalls ab und stießen als Demokratien zur Gemeinschaft. Auch Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo und Mazedonien stehen als Kandidaten vor der Tür. Montenegro, Serbien und die Türkei weisen sogar Verhandlungsstatus für ihre Aufnahme in die Europäische Union vor. Gegen eine baldige Aufnahme der Türkei spricht der augenblickliche Trend in Richtung Autokratie, aber in den Mitgliedstaaten Polen und Ungarn ist die gleiche Entwicklung auszumachen, ohne dass bisher Sanktionen erfolgt sind. Worauf ist dieser Trend trotz wirtschaftlichen Aufschwungs zurückzuführen, der, wie gesagt, auch Überraschungen wie die Wahl des amerikanischen Präsidenten bereithält? Für den Einzelfall kursieren viele Erklärungen, aber in diesen Ländern – und in vielen anderen in zunehmendem Maß auch – haben Parteien die Mehrheit bei Wahlen gewonnen, die oftmals nicht der Stimmenmehrheit entsprach. Diesen Unterschied erklärt die politische Ökonomie aus den Feinheiten des Wahlsystems, das vielerorts ländliche gegenüber städtischen Wahlkreisen übergewichtet. Ländliche Interessenlagen erfahren auf diese Weise eine Art Minderheitenschutz gegenüber den zahlenmäßig größeren städtischen Interessenlagen, was auf die Zeit der Demokratiegründungen im Zuge der Industrialisierung zurückgeht. Damals war ein Interessenausgleich notwendig zwischen ländlichen und den stark wachsenden städtischen Bevölkerungen, die durch das Land ernährt werden mussten. In Polen, Ungarn und der Türkei verdeckt der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre seine ungleiche Verteilung, von der die Metropolen Warschau, Budapest und Istanbul profitieren, wohingegen die Entwicklung des ländlichen Raums und der suburbanen Gebiete wie in einer trostlosen Einöde stagniert. Mittlerweile ersetzt vielerorts der Gegensatz Metropole versus Einöde den traditionellen Stadt-Land-Konflikt. In den Metropolen existiert ein großes Angebot, eine Meinungsvielfalt über Medien und eine Wissenskonkurrenz, die von Schulen und Universitäten vermittelt wird. Das macht sie attraktiv für jüngere, (aus)gebildete und mobile Bevölkerungsschichten, die ihre Zukunft nicht mehr in der trostlosen Einöde sehen. Ihr Exodus verschärft das Missverhältnis. Der Weggang der Jüngeren und (Aus-)Gebildeten und das Fehlen von Ärzten und Infrastruktur machen die Zukunftslosigkeit der Einöde deutlich. Unter diesen Umständen sind Botschaften mit einfachen Lösungsangeboten von Parteien mit charismatischen Kandidaten erfolgreich, die Schutz vor dem weiteren Verfall versprechen. Um dieses Ziel zu erreichen und um die Einöde vor der Bedrohung durch ausländische Kräfte zu bewahren, werden individuelle Freiheiten und der pluralistische Wettbewerb um Angebote, Meinungen und Wissen eingeschränkt, was in der Einöde wenig, in den Metropolen dagegen vieles ändert. Einmal an der Macht, ist für die Umsetzung dieser Ziele die Kontrolle der regierenden Partei ausschlaggebend. Im Fall Polens, Ungarns und der Türkei kontrollieren Jaroslaw Kaczynski, Viktor Orbán und Recep Tayyip Erdogan die regierende Partei, die mit ihrer Parlamentsmehrheit Gesetze zum Abbau des Rechtsstaats verabschiedet. Hier dürfte ein wesentlicher Unterschied zu Donald Trump liegen, der als Kandidat zwar die Wahl zum amerikanischen Präsidenten gewinnen konnte, aber dem die Kontrolle der Republikanischen Partei nicht gelingt. Gegenüber der polnischen, ungarischen oder türkischen dürfte sich daher die amerikanische Demokratie als stabiler erweisen. Aber was macht eigentlich die Europäische Union, wenn ihre Mitglieder und Beitrittskandidaten die Gewaltenteilung einschränken und den Rechtsstaat abbauen, auf dessen Prinzip ihr gemeinsamer Binnenmarkt mit seinen Freizügigkeiten beruht? Wie kann und sollte man darauf reagieren, wenn die Ursachen im strukturellen Gegensatz zwischen Metropolen und Einöde liegen? Im Fall der Central European University hat die EU-Kommission wenige Tage nach Beschluss des Sondergesetzes der ungarischen Regierung Auskunft gegeben, wie diese ihre Forschungsförderung durch die Europäische Union verbessern könne. Offensichtlich möchte die ungarische Regierung nicht die Forschung abschaffen, sondern lediglich ihre Vielfalt einschränken und auf Bereiche wie Landwirtschaft, Ingenieurwesen und Medizin konzentrieren. Anstatt darüber Auskunft zu geben, wie dieses Vorhaben besser gelingen kann, wäre ein Ausschluss Ungarns von der Forschungsförderung der Europäischen Union vielversprechender. Schließlich würde ein solcher Ausschluss nicht die ungarische Bevölkerung im Allgemeinen, sondern die Forschungspolitik der ungarischen Regierung treffen, die durch ihr Sondergesetz den pluralistischen Wettbewerb um Wissen einschränkt und dadurch gegen das Rechtsstaatsprinzip verstößt, auf dem die EU und ihr Binnenmarkt beruht. Thomas König ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mannheim und leitet dort den Sonderforschungsbereich „Politische Ökonomie von Reformen“.
www.cambridge.org
Sehr geehrter Herr Kollege Bierling, mit Interesse habe ich heute ihren Mannheimer Morgen Gastbeitrag „Trump-Wahl: Warum wir falsch lagen“ gelesen, der auf einen datenlastigen Trend hinweist, den wir nicht nur in der Politik(wissenschaft), sondern auch in Wirtschaft und Gesellschaft beobachten. Allerdings stelle ich mir angesichts dieses Datentrends die Frage, ob die Politikwissenschaft nicht viel mehr zur Vermittlung von Mathematik- und Statistikkenntnissen beitragen müsste, um etwaigen Fehlinterpretationen und -entwicklungen entgegen zu wirken. Aber zunächst möchte ich erwähnen, dass mir an Ihrem Beitrag sehr gut gefallen hat, wie Sie auf den strukturellen Unterschied zwischen dem „Heart- und dem Küstenland“ in den Vereinigten Staaten aufmerksam machen. Verallgemeinernd könnte man vielleicht erwähnen, dass im Heartland eine Koalition zwischen Land (Green) und Arbeit (Red) Donald Trump zum Sieg verholfen hat. Ähnliche Koalitionen waren beim Brexit-Votum ausschlaggebend und sind auch in Polen, Frankreich oder (Ost)Deutschland anzutreffen. Abgesehen vom Wahlsystem dürfte aus politikwissenschaftlicher Sicht interessant sein, dass sich in eher reichen Staaten diese Green/Red-Koalition bei Welthandelsfragen gegen das Kapital richtet (Rogowski 1990, Commerce and Coalitions, 15). Das könnte einen Hinweis auf die geringe Mobilisierungskraft von Hillary Clinton geben, die sich im Gegensatz zu Bernie Sanders für Freihandelsabkommen ausgesprochen hat. Schließlich galt Hillary Clinton mehr dem „freihändlerischem“ Kapital als der Milliardär Donald Trump verbunden, der die eher protektionistischen Interessen von Land und Arbeit zu vertreten verspricht. Mit Recht haben Sie darauf hingewiesen, dass die meisten Meinungsumfragen ein verzerrtes Bild zeichneten, wenn auch nicht alle Kollegen Meinungsumfragen für die Erstellung von Prognosen verwendet haben, siehe bspw. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F374BCB3C2A291B21A8A39CD3ECD6BE3/S1049096516001323a.pdf/primary-model-predicts-trump-victory.pdf. Dennoch spielen diese Daten eine zunehmende Bedeutung – nicht nur in der Politik, sondern auch in Wirtschaft und Gesellschaft. Sicherlich kann man darüber spekulieren, ob dieser Datentrend einem rationalen Erkenntnisinteresse, einer recht kostengünstigen Unterhaltungsform oder eher einem ideenlosen Programm geschuldet ist. Einen ersten Hinweis darauf dürften die Adressen der Auftraggeber geben, von denen meiner Kenntnis nach nur wenige in der Politikwissenschaft zu finden sind. Die Politikwissenschaft wäre in der Tat auf dem von Ihnen beschriebenen Irrweg, wenn diese sich auf die zunehmende Anzahl an Meinungsumfragen stützen würde. Schließlich weisen diese (auch hierzulande) oftmals gravierende methodische Defizite auf. Abgesehen vom bekannten Selektionsbias vieler Internetumfragen erfüllen die zum Brexit und zur amerikanischen Präsidentschaftswahl durchgeführten Meinungsumfragen nicht die Grundbedingung einer Zufallsauswahl der Befragten. So werden in den USA vornehmend Telefonumfragen durchgeführt, die nur Festnetzt-, nicht aber die kostenpflichtigen Mobilfunkteilnehmer einbeziehen. Soweit mir bekannt existieren darüber hinaus so gut wie keine Längsschnittbefragungen, die aber für die Erforschung der von Ihnen bzw. Kathy Cramer beschriebene Entwicklung notwendig wären. Auch hierzulande fühlen sich einzelne Bevölkerungsgruppen zunehmend gegenüber Einwanderern benachteiligt, was nicht unbedingt an den Einwanderern, sondern eher an den strukturellen Veränderungen liegen dürfte, die Arbeiter und Land gegen das eher städtische Kapital aufbringen. Kurzum, (Daten aus) Meinungsumfragen und den darauf basierenden Prognosen sollte – wenn überhaupt – nur dann Aufmerksamkeit gezollt werden, wenn sie die methodischen Grundbedingungen erfüllen. Das gilt für die Politikwissenschaft genauso wie für Wirtschaft und Politik, die diese vermehrt in Auftrag geben. Aufgrund fehlender mathematisch-statistischer Kenntnisse können diese Grundlagen allerdings weder die Auftraggeber noch die Bevölkerung ausreichend bewerten. Deshalb dürfte/müsste doch eine Aufgabe der Politikwissenschaft in der Vermittlung dieser Grundlagen liegen, um etwaigen Fehlinterpretationen und -entwicklungen entgegen zu wirken. Anders ausgedrückt teile ich zwar ihre Beobachtung, komme aber zum konträren Schluss: angesichts des datenlastigen Trends in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sollte eine Zukunftsaufgabe der Politikwissenschaft in der Vermittlung mathematisch-statistischer Kenntnisse liegen, die hierzulande leider nur an vereinzelten Orten erworben werden können, mit freundlichen Grüßen Thomas König
Primary Model Predicts Trump Victory | PS: Political Science & Politics | Cambridge Core
Trumps Wahlsieg nicht für alle überraschend.... https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/primary-model-predicts-trump-victory/F374BCB3C2A291B21A8A39CD3ECD6BE3
The Division of the Social Sciences at the University of Chicago Dear Prof. König, Our faculty have found your letters of recommendation invaluable in assessing past doctoral and MA applicants to the University. Our selection committees could not do their work without you. I wanted to share some important news: A Changing PhD Environment Encouraging our best students to apply for the PhD is something we are glad to do. Increasingly we wonder, however, about their career and placement outcomes. Will the long haul of the PhD prove worthwhile? We also recognize that the landscape of doctoral admission has changed. Not only are the cohorts smaller, but well over 50% of admitted students now come with an elite MA degree in hand. That’s true for top programs in Anthropology, Economics, History, Political Science, and Sociology. Even in Psychology, long an outlier in that regard, the tide has begun to turn. Most MA programs, meanwhile, are simply revenue generators. They admit a large volume of applicants, often train them with a separate faculty, and provide some cursory placement support. Students are fortunate if they receive more than token financial aid packages. Will our best students be advantaged or disadvantaged by the PhD path? Just how encouraging should we be? What Makes UChicago Different We have a very different set of MA programs at the University of Chicago. So different that this year, more than 50 students turned down fully funded PhD offers to join us. Another 40 came with the MA already in hand from a top university overseas. Why do they make that choice? Our students have full access to our doctoral classes, and full access to UChicago faculty. That means they receive the same training as first-year doctoral students, and work directly with our departmental faculty on the MA thesis. They are mentored by prize-winning PhD students of the University, who provide weekly feedback on everything from course selections to the development of their MA papers. Their placement outcomes are phenomenal: As many as 96 students per year go on for funded PhD study, at 93% placement rates, averaging almost 4 PhD offers each. Those who decide not to pursue the PhD work closely with our Director of Career Services, someone focused exclusively on our MA programs. She hosts biweekly workshops, brings alumni mentors to campus, organizes paid and unpaid internships, and invites employers for career recruitment events. Our MA students receive career-level employment within 5 months of graduation, on accelerated career tracks. 97% of our students receive significant financial aid, between one-third and one-half tuition. Our very best applicants receive 2/3 and full tuition offers. What makes our UChicago faculty most proud: Following a 2012 Provost survey, our alumni has the highest satisfaction rates of the entire University, five years after graduation. We Hope You’ll Recommend Your Best Students Your past letters of recommendation have been highly prized by our selection committees. Your judgment, your mentorship, and your training have helped us recruit some exceptional candidates. Our current MA students represent more than 200 undergraduate institutions. 40% are international, from 24 different countries. 22% of our US citizens identify as racial minorities. 53% of our MA students are women. The average age is 24. We couldn’t recruit such talented students without you. We hope you’ll continue to send your most promising candidates our way. What We Offer at the University of Chicago MA Program in the Social Sciences (MAPSS) - the largest, most diverse, and most successful MA program in the social sciences. Students specialize in Anthropology, Economics, History, Political Science, Psychology, Sociology, or in interdisciplinary study. More students go on for the PhD than from any MA program in the world. There are more than 100 MAPSS graduates studying for the PhD at UChicago alone. Committee on International Relations - the nation’s oldest and highly distinguished MA program in international relations. Students examine the historical, comparative, formal, and theoretical bases for international organizations, international security, non-governmental organizations, and related economic, environmental, and social movements. MA Program in Computational Social Science - our newest MA program, exploring the latest innovations in machine learning, statistical inference, and large data analysis to engage big questions about our social world. Students receive comprehensive training in computational methods and serious exposure to their disciplinary field. Our aim is to produce the next generation of social scientific researchers. MA Program in Middle Eastern Studies - is there a part of the world that more urgently needs thoughtful attention, a historical perspective, and the ability to read widely in relevant languages? Students select individually-tailored curricula, depending on their linguistic, regional, and historical interests. Our faculty focus on countries from Morocco to Kazakhstan - including Turkey, Israel, and Iran - in both historical and contemporary perspective. MA Program in Latin American and Caribbean Studies - housed in a leading center for Latin American studies, with highly individualized study and very close faculty mentorship. Students develop regional expertise for a variety of fields, from academia and non-profits to public policy and law. We have an exceptionally diverse faculty, with regional strengths in Mexico, Brazil, Colombia, Cuba, and Latino populations in the U.S. Applications Due January 4 and April 30 Please encourage your students to apply for January 4th. Those applications are read first and most generously. Anyone applying later is still considered for financial aid on the same terms. Feel Free to Circulate this Notice We encourage you to forward this announcement on your department listserv, or to any of your alumni. Contact Our Staff Our staff would be delighted to talk about how our MA programs can help students take the next steps with their research. Please do not hesitate to contact me, our Student Affairs Administrator E.G. Enbar, or our Associate Dean of Students Kelly Pollock. We can redirect your inquiries as needed, to help your students apply as competitively as possible. Thank you very much for your time and consideration! Sincerely, Chad Cyrenne, PhD Managing Director MA Programs in Social Sciences Division of the Social Sciences 1130 East 59th Street Chicago, Illinois 60637 Phone: (773) 702-8415 admissions@ssd.uchicago.edu
When Teamwork Doesn’t Work for Women
Publish or Perish - gilt das auch für Männer und Frauen gleichermaßen? http://www.nytimes.com/2016/01/10/upshot/when-teamwork-doesnt-work-for-women.html?_r=1
Außenansicht – Wider den Kuhhandel
http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-wider-den-kuhhandel-1.3072134
Kann der Fussball etwas von der Politikwissenschaft lernen? Ein typisches Beispiel für die Beantwortung dieser Frage dürfte das Halbfinalspiel Frankreich gegen Deutschland sein, in dem Frankreich in der 46. Minute der ersten Halbzeit ein Handelfmeter zugesprochen wurde. Vermutlich war diese Szene spielentscheidend, da sich die Heimmannschaft Frankreich in der zweiten Hälfte – wie viele Teams bei dieser Europameisterschaft – einigeln und auf einen Fehler Deutschlands warten konnte, um das Spiel zu entscheiden. Eine Schlussfolgerung dieser wenig berauschenden Europameisterschaft, die der UEFA die Rekordsumme von fast 2 Milliarden Euro auf Kosten der bisherigen Wettbewerbsqualität von Europameisterschaften einbrachte, dürfte sein, dass sich Fussball der Handballspielweise annähert und sich Mannschaften mit Mann und Maus der Verteidigung des eigenen Strafraums verschreiben. Diese Strategie scheint generell erfolgversprechend zu sein und selbst Heimmannschaften, die technisch und spielerisch unterlegen sind, eine Siegchance einzuräumen. Und trotzdem stellt sich am Ende die Frage, ob die Entscheidung für diesen Handelfmeter gerechtfertigt war. Aber wie lässt sich darauf eine Antwort finden? Die Kommentatoren scheinen sich einig zu sein, dass man diesen Handelfmeter geben kann, aber die aus politikwissenschaftlicher Sicht entscheidende Frage müsste gKann der Fussball etwas von der Politikwissenschaft lernen? Ein typisches Beispiel für die Beantwortung dieser Frage dürfte das Halbfinalspiel Frankreich gegen Deutschland sein, in dem Frankreich in der 46. Minute der ersten Halbzeit ein Handelfmeter zugesprochen wurde. Vermutlich war diese Szene spielentscheidend, da sich die Heimmannschaft Frankreich in der zweiten Hälfte – wie viele Teams bei dieser Europameisterschaft – einigeln und auf einen Fehler Deutschlands warten konnte, um das Spiel zu entscheiden. Eine Schlussfolgerung dieser wenig berauschenden Europameisterschaft, die der UEFA die Rekordsumme von fast 2 Milliarden Euro auf Kosten der bisherigen Wettbewerbsqualität von Europameisterschaften einbrachte, dürfte sein, dass sich Fussball der Handballspielweise annähert und sich Mannschaften mit Mann und Maus der Verteidigung des eigenen Strafraums verschreiben. Diese Strategie scheint generell erfolgversprechend zu sein und selbst Heimmannschaften, die aber technisch und spielerisch unterlegen sind, eine Siegchance einzuräumen. Und trotzdem stellt sich am Ende die Frage, ob die Entscheidung für diesen Handelfmeter gerechtfertigt war. Die Kommentatoren scheinen sich einig zu sein, dass man diesen Handelfmeter geben kann, aber aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich diese Frage nur kontrafaktisch gestellt beantworten, also ob dieser Handelfmeter gegeben worden wäre, wenn sich diese Szene im französischen Strafraum abgespielt hätte. Spätestens hier werden die meisten Beobachter inne halten und sich erinnern, dass der italienische Schiedsrichter schon zuvor bisweilen zugunsten Frankreichs entschieden hat. Und wenn dem so ist, dann stellt sich die nächste Frage nach der Endogenität, also ob die Auswahl des Schiedsrichters eine Vorentscheidung für die Vergabe eines Handelfmeters war, der wahrscheinlicher im deutschen als im französischen Strafraum gegeben wurde. Mit Blick auf die UEFA-Bilanz fällt aucb hier die Antwort leicht, aber als Politikwissenschaftler ist uns am Ende die deutsch-französische Freundschaft wichtiger als die kontrafaktische Beantwortung der Handelfmeter- oder Auswahlfrage der italienischen Schiedsrichter....:-)
Prof. Dr. Thomas König - Lehrstuhl Internationale Beziehungen
I have been asked by colleagues, students and others, why I wrote the Brexit article only in German…… Brexit- but where? British Prime Minister David Cameron has miscalculated and resigned after the British majority had voted for the Brexit. To unify his fractious Conservative Party and to stop the rise of the Eurosceptic UKIP, the British Prime Minister announced in January 2013 to hold a referendum on the United Kingdom’ membership in the European Union (EU) in case of his re-election in the upcoming British election. This move by the British prime minister could resolve the Conservative Party’s conflict over EU membership – a conflict that was not apparent in competing parties like Labour and Liberals. After his Conservative Party somewhat surprisingly won the absolute majority of parliamentary seats with about 37% votes in May 2015, the plan of the British Prime Minister seemed to be working. Persuaded in his ability to convince the British voters of the country’s benefits from EU membership, the British Prime Minister fought with similar arguments, which convinced the Scots to vote for remaining in the United Kingdom in a referendum of September 2014: the danger of economic disadvantages, the loss of power and influence on the world markets as well as the general risks of a more uncertain future, motivated the Scots for a stay in the UK, but could not convince the British for a common future with the EU. Even the so-called "terms" as the concessions for a continuing British membership in the EU, which the British Prime Minister negotiated ahead of the referendum with the Member States, could not overcome the concerns of a British majority in the end. Now Britain will leave the EU and David Cameron resigned. For many observers, this outcome is suprising. Indeed, the prospects for the UK from leaving the EU are more uncertain as the leaving of Scotland from the UK - by the way a question that is likely to be back on the British agenda when considering the regional distribution of the referendum results. After all, 62% of Scots voted to remain in the EU. Further uncertainty exists about the status and conditions that will be imposed for the UK’s exit from the EU. Not only that some Member States are concerned that "too good" conditions for the UK could give rise to other Member States to consider an exit from the EU. Moreover, an agreement requires consensus of all Member States; otherwise the UK will only receive the status of a third country. Apart from the Scotland issue the exit of Britain from the EU could revitalise a conflict that already seemed to be forgotten by the joint EU membership with Ireland: the Northern Ireland question, which held the UK in breath from 1969 to 1998. For territorial issues such as Northern Ireland, South Tyrol, the Basque Country, Corsica etc. the EU historically acts pacifying by curbing the centralizing forces of the respective national governments. The joint membership imposes a common regulatory framework that reduces the minorities’ impression and fears about centralization. Again, a look at the regional distribution of the referendum results shows that 55.8% of the population in Northern Ireland voted to remain in the EU, with a cleavage between Catholic and Protestant constituencies. Interestingly, it is still a completely open question, in which direction the new British Prime Minister will negotiate the exit from the EU. In addition to the concerns of the Member States, another reason is that the supporters of the Brexit consist of at least two very different, perhaps opposing camps: on the one side are the protectionists, who want to shield the United Kingdom from immigration, terrorists, etc. by imposing national regulations that aim to reduce these globalization effects. On the other side of the Brexit supporters are the liberalizers who feel overregulated by Brussels and want to develop the United Kingdom towards an unregulated country open for global trade. Although both camps commonly supported the Brexit, and are mainly attributable to the Conservative Party, it is not clear in which direction the new British Prime Minister will go. However, all of these aspects should not be used to draw the conclusion that the British majority did take an emotional or even irrational decision respectively that the EU is in a good shape. Certainly, David Cameron's campaign for remaining in the EU could not show how open and perhaps contested the British direction will be after the Brexit. It is not exlcuded that the Brexit will threaten the unity of the United Kingdom and finally lead to an exit only of England. Until now, however, the EU itself is also unable to provide a credible answer on its own direction, which is indicated by a declining public support for European integration and the rise of Eurosceptic parties in almost all Member States. Thematically, the EU has no answers on the most important questions about immigration, debt and (youth) unemployment. Institutionally, there is a decreasing turnout at European Parliament elections, although it has been claimed that parliamentary empowerment will overcome the democratic deficit in the EU. Similar to the campaign of the British Prime Minister Cameron, proponents of European integration continuously point to the dangers of economic disadvantages, the loss of power and influence on the world markets as well as the risks of a more uncertain future without the EU, without being able to provide answers to the most important issues. Furthermore, the permanent usage of this formula leads to a loss of credibility, which Eurosceptic parties and movements understand to exploit for their anti-campaigns. When anti-campaigns do not need to specify their own direction under these conditions, they can have success with an umbrella function for different disappointed camps. The many surveys that have been carried out in the UK in the wake of the referendum could not predict the outcome, but they revealed a significant difference between supporters and opponents of a Brexit: compared to the opponents, the Brexit proponents had very stable views and preferences. Hence, it will take more to regain credibility and support for European integration. #brexit #europe #referendum
Brexit- aber wohin? Der britische Premierminister David Cameron hat sich verrechnet. Um seine zerstrittene Konservative Partei zu einen und der europaskeptischen UKIP das Wasser abzugraben, hatte der britische Premierminister im Januar 2013 für den Fall seiner Wiederwahl bei den britischen Parlamentswahlen ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union (EU) angekündigt. Mit diesem Schachzug konnte der britische Premierminister den Konflikt über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens beseitigen, der sich fast ausschließlich innerhalb seiner Konservativen Partei und nicht bei den Konkurrenzparteien wie Labour und Liberals aufgetan hatte. Nachdem seine Konservative Partei im Mai letzten Jahres etwas überraschend mit einem Stimmenanteil von etwa 37% die absolute Mandatsmehrheit im britischen Parlament errang, schien der Plan des britischen Premierministers aufzugehen. Fest in dem Glauben, nach seinem Sieg bei den Parlamentswahlen die britische Bevölkerung von den Vorzügen einer EU-Mitgliedschaft überzeugen zu können, kämpfte der britische Premierminister mit ähnlichen Argumenten, die noch im September 2014 die Schotten für einen Verbleib in Großbritannien bewegen konnten: die Gefahr von ökonomischen Nachteilen, eines Verlusts an Durchsetzungskraft auf den Weltmärkten wie auch die allgemeinen Risiken einer ungewisseren Zukunft konnten die Schotten schließlich für einen Verbleib in Großbritannien, nicht aber die Briten für eine gemeinsame Zukunft mit der EU überzeugen. Selbst die sogenannten „terms“ als den Zugeständnissen für Großbritannien, die der britische Premierminister im Vorfeld des Referendums von den Mitgliedstaaten für den Fall des Verbleibs Großbritanniens in der EU erhielt, reichten den Briten am Ende nicht aus. Nun wird Großbritannien die EU verlassen und David Cameron zurücktreten. Dabei sind die Aussichten für ein Großbritannien außerhalb der EU unsicherer als ein Weg Schottlands ohne Großbritannien – übrigens eine Frage, die schon nach der regionalen Betrachtung der Referendumsergebnisse bald wieder auf der britischen Agenda stehen dürfte. Immerhin stimmten 62% der Schotten für den Verbleib in der EU. Weitere Unsicherheit besteht über den Status und die Konditionen, die Großbritannien für seinen Austritt aus der EU auferlegt werden. Nicht nur, dass einige Mitgliedstaaten befürchten, dass „zu gute“ Konditionen für Großbritannien durchaus anderen Mitgliedstaaten Anlass geben könnten, sich ebenfalls über einen Austritt Gedanken zu machen. Darüber hinaus muss eine Einigung über die Austrittsmodalitäten im Konsens aller Mitgliedstaaten erzielt werden, wenn Großbritannien nicht alle Rechte verlieren und nur noch den Status eines Drittstaates erhalten soll. Abgesehen von der Schottlandfrage könnte der Austritt Großbritanniens bald wieder einen Konflikt auftreten lassen, der durch die gemeinsame Mitgliedschaft mit Irland in der EU schon in Vergessenheit zu geraten schien: die Nordirlandfrage, die von 1969 bis 1998 Großbritannien in Atem hielt. In historischen Territorialfragen wie Nordirland, Südtirol, Baskenland, Korsika etc. wirkt die EU bislang pazifierend, indem sie die Zentralisierungskräfte der jeweiligen Nationalstaaten zügelt. Durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu einem europäischen Regelwerk wird vor allem der Eindruck vermieden, Büttel einer Zentralregierung zu sein. Auch hier hilft ein Blick auf die regionale Verteilung der Abstimmungsergebnisse. In Nordirland haben immerhin 55.8% der Bevölkerung für den Verbleib in der EU gestimmt, wobei ein Riss durch katholische und protestantische Wahlbezirke ging. Interessanterweise ist nach wie vor völlig offen, in welche Richtung der neue Premierminister mit seiner konservativen Parlamentsmehrheit verhandeln wird. Die Austrittsfront setzt sich nämlich aus zwei sehr unterschiedlichen Lagern zusammen, auf der einen Seite stehen die Protektionisten, die Großbritannien vor Einwanderung, Terroristen etc. bewahren und hierfür Regelungen treffen wollen, die diese Globalisierungseffekte reduzieren sollen. Auf der anderen Seite derselben Front stehen aber die Liberalisierer, die sich durch Brüsseler Regelungen eingeschränkt fühlen und Großbritannien eher zu einem liberalen Platz des globalen Handels entwickeln wollen. Auch wenn beide Lager für den Austritt stimmten und vor allem der Konservativen Partei zuzurechnen sind, ist nicht klar, in welche Richtung die neue Regierung gehen wird. All diese Aspekte sollten aber nicht zur der Schlussfolgerung verleiten, die Briten hätten emotional oder sogar irrational abgestimmt. Sicherlich kann man der Cameron's Kampagne für den Verbleib in der EU nachsagen, dass es nicht gelungen ist, die Frage nach der Richtung Großbritanniens im Fall eines Austritts zu thematisieren. Aber die EU selbst lässt so viele Fragen offen, die auch außerhalb Großbritanniens die Zustimmung zur Europäischen Integration sinken lassen. Thematisch wurden bislang keine Antworten auf die wichtigsten Fragen nach Immigration, Schulden und (Jugend)Arbeitslosigkeit gefunden. Institutionell sinkt nicht nur kontinuierlich die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament, sondern es steigt auch die Anzahl und die Unterstützung von euroskeptischen Parteien, die wichtige Träger in der politischen Willensbildung sind. Ähnlich wie die Kampagne des britischen Premierministers Cameron beschwören die Befürworter der Europäischen Integration nach wie vor die ökonomischen Nachteile, den Verlust an Durchsetzungskraft auf den Weltmärkten wie auch die Risiken einer ungewisseren Zukunft ohne EU, ohne jedoch Antworten auf die wichtigsten Themen geben zu können. Der permanente Gebrauch dieser Formel führt allerdings zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit, den euroskeptische Parteien und Bewegungen zu nutzen verstehen. Die vielen Meinungsumfragen, die in Großbritannien im Zuge des Referendums durchgeführt wurden, konnten zwar nicht das Ergebnis vorhersagen. Allerdings zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen Befürwortern und Gegnern eines EU-Austritts: im Vergleich zu den Gegnern hatten die Austrittsbefürworter sehr stabile Ansichten und Präferenzen. Es braucht also mehr, um Glaubwürdigkeit und Zustimmung zur Europäischen Integration zurückzugewinnen. #brexit #uk #europe #europa #referendum
APSA Announces New Editorial Team for the American Political Science Review
http://www.politicalsciencenow.com/apsa-announces-new-editorial-team-for-the-american-political-science-review/
Quiz