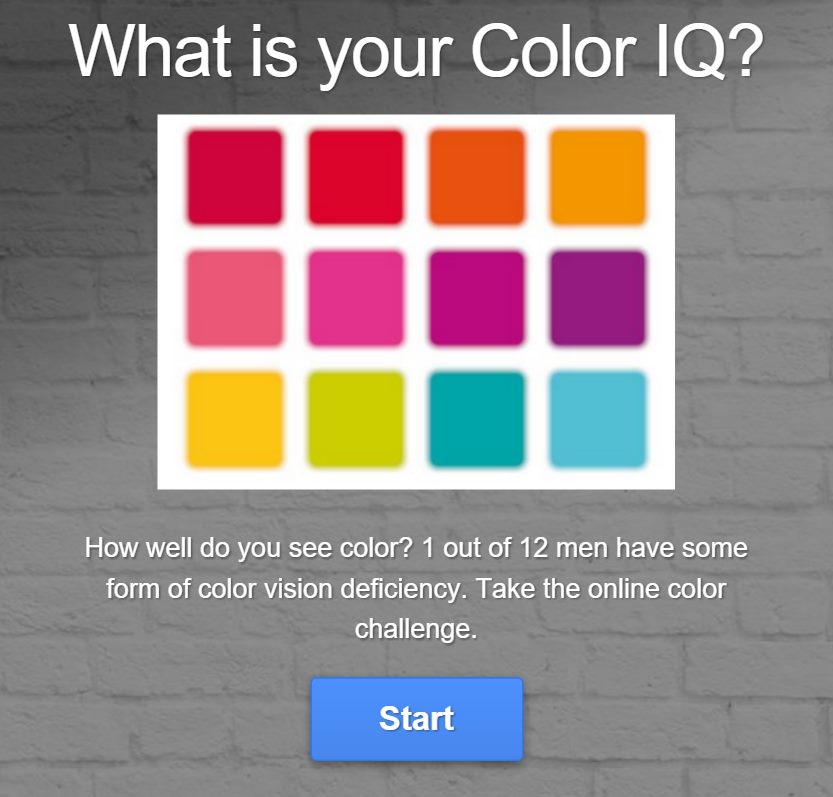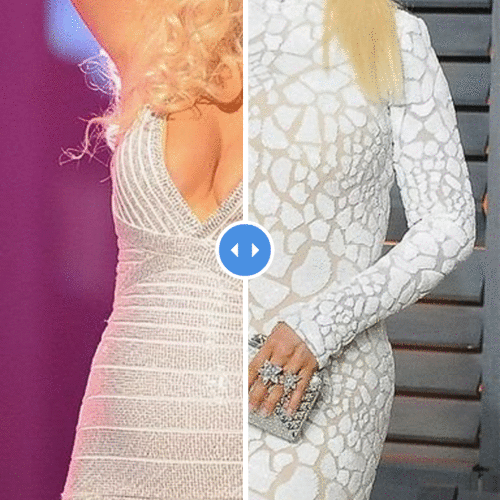Description
Unsere Kanzlei befindet sich in zentraler Lage in Ansbach direkt am Bahnhofsplatz. Wir beraten mittelständische Unternehmen, Einzelfirmen wie auch Privatpersonen. Mit vielen Mandanten, die wir sowohl beratend wie forensisch vertreten, verbinden uns langjährige Geschäftsbeziehungen.
Unser Mandantenstamm vertraut auf unsere Kernkompetenzen, die insbesondere im Arbeitsrecht, Erbrecht, Miet -und WEG-Recht sowie Verkehrsrecht liegen. Weitere Schwerpunkte sind das Werkvertrags- / private Baurecht, Strafrecht, Produkthaftungsrecht sowie das Forderungsmanagement.
Als Rechtsanwälte sind wir seit 1996 (RA B.Bauer) bzw. seit 2001 (RA S.Wawarta) tätig.
Tell your friends
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.comÜberwachung Observation verletzt Persönlichkeitsrecht Ein Betriebsratsvorsitzender hat Anspruch auf Entschädigung, wenn der Arbeitgeber ihn während der Arbeitszeit von einem Detektiv beschatten lässt. Denn darin liegt eine schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz sprach dem Geschädigten 10.000 Euro zu. Im Fall ging es um den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden eines Unternehmens, der zunächst freigestellt war, obwohl die Mindestgrenze aus dem BetrVG nicht erreicht war. Später hob der Arbeitgeber die Freistellung auf. Der Fall landete vor dem Arbeitsgericht. Im laufenden Verfahren schaltete der Arbeitgeber einen Detektiv ein, der den Betriebsrat während der Arbeitszeit überwachen sollte. Persönlichkeitsrecht verletzt Das LAG Rheinland-Pfalz führt aus, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Arbeitnehmers auch dann schwerwiegend verletzt sein kann, wenn der Arbeitgeber behauptet, er habe den Arbeitnehmer ausschließlich während seiner Arbeitszeit von einer Detektei beobachten lassen, die im Rahmen der Observationen keine Fotografien oder Videoaufzeichnungen angefertigt habe. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist »selbstverständlich auch im Arbeitsverhältnis und während der Arbeitszeit zu beachten«, heißt es im Urteil. Dauer und Anlass der Maßnahme sind entscheidend Entscheidend ist hier die lange Dauer und Intensität der Überwachung – nämlich über einen Zeitraum von 20 Arbeitstagen und rund vier Stunden täglich. Wäre es eine staatliche Überwachung gewesen, hätte es der Genehmigung eines Richters bedurft – dem Arbeitgeber dürften keinesfall weitergehende Rechte zugestanden werden. Daneben bestand kein berechtigter Anlass für heimliche Observationsmaßnahmen. Nicht zuletzt verstoße die heimliche Überwachung des Klägers durch eine Detektei auch gegen betriebsverfassungsrechtliche Schutzbestimmungen. Dieser Verstoß verstärkt den Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das gelte auch, weil die Überwachungsmaßnahme während des laufenden arbeitsgerichtlichen Verfahrens beauftragt wurde, in dem das Gericht verantwortlich sei, die Tatsachen zu ermitteln. Das LAG Rheinland-Pfalz hielt daher 10.000 Euro Entschädigung für angemessen. Quelle: LAG Rheinland-Pfalz, 27.04.2017 Aktenzeichen: 5 Sa 449/16
Tarifeinheitsgesetz verfassungsmäßig Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz von 2015 ist mit dem Grundgesetz vereinbar – so das Bundesverfassungsgericht. Der Grundsatz der Tarifeinheit bestimmt, dass in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag anwendbar sein soll – nämlich jener der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Allerdings muss der Gesetzgeber beim Schutz kleinerer Berufsgewerkschaften wie GDL oder Cockpit noch nachbessern, fordern die Karlsruher Richter. Ordnungsregel »Ein Betrieb, ein Tarifvertrag« Die Tarifeinheit, das Prinzip »ein Betrieb, ein Tarifvertrag« war lange Zeit überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Bis zum Jahr 2010 wandten die Arbeitsgerichte die Tarifeinheit als Kollisionsregel für den Fall an, dass für einen Betrieb Tarifverträge mehrerer Gewerkschaften anwendbar waren. Nach dem Spezialitätsprinzip erklärten die Gerichte den Tarifvertrag für anwendbar, der dem Betrieb räumlich, betrieblich, fachlich und persönlich am nächsten stand und deshalb den Erfordernissen und Eigenarten des Betriebs am ehesten gerecht wurde. Dieses Prinzip gab das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2010 auf (BAG, Beschlüsse vom 23.06.2010 – 10 AS 2/10 und 10 AS 3/10). Der zehnte Senat des BAG stellte fest, dass es keinen übergeordneten Grundsatz gebe, wonach für verschiedene Arbeitsverhältnisse derselben Art in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag gelten könne. Nachdem in der Folge etwa die Lokführergewerkschaft GDL Arbeitskämpfe mit längeren Streiks führte, um eigene Tarifverträge durchzusetzen, die sich von denen der Branchengewerkschaft EVG deutlich abhoben, kam die politische Forderung auf, die Tarifeinheit gesetzlich zu regeln. Von der Regel zum Gesetz Am 3. Juli 2015 ist das umstrittene Tarifeinheitsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz fügt eine neue Kollisionsregel in das Tarifvertragsgesetz (TVG) ein. Sie greift, wenn sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften in einem Betrieb überschneiden. Nach § 4a Abs. 2 Satz 2 TVG wird der Kollisionsfall dahingehend gelöst, dass nur der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft im Betrieb Anwendung findet, die in diesem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Eine Gewerkschaft, deren Tarifvertrag verdrängt wird, kann sich dem Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft durch eine Nachzeichnung anschließen. Ergänzend wurde im Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) mit § 2a Abs. 1 Nr. 6, § 99 ArbGG ein weiteres Beschlussverfahren aufgenommen. In diesem Verfahren kann das Arbeitsgericht verbindlich mit Wirkung für alle Parteien klären, welcher Tarifvertrag nach der Kollisionsregel im Betrieb zur Anwendung kommt. Eingriff ins Koalitions- und Streikrecht befürchtet Während die Arbeitgeberverbände und die Mehrheit der DGB-Gewerkschaften das Gesetz als ordnungspolitische Maßnahme befürworteten, sahen die kleineren Gewerkschaften wie GDL, Vereinigung Cockpit und Marburger Bund das Gesetz als Eingriff in die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) an und legten Verfassungsbeschwerde ein. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Deutsche Beamtenbund (DBB) schlossen sich an. Die Beschwerdeführer machten geltend, das Gesetz beeinträchtige die in Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Tarifautonomie der Gewerkschaften, da ihr Recht beeinträchtigt werde, effektive Tarifverträge zu schließen. Auch das Streikrecht könne dadurch ins Leere laufen: Denn die Arbeitsgerichte könnten einen Streik leichter als unverhältnismäßig verbieten, wenn der Tarifvertrag, den die Gewerkschaft erkämpfen will, wegen der Kollisionsregel ohnehin nicht anwendbar ist. Karlsruhe fordert nur Nachbesserung im Detail Diese Verfassungsbeschwerden hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) allerdings am 11.07.2017 abgewiesen. Das Tarifeinheitsgesetz sei weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar. Nur Auslegung und Handhabung des Gesetzes müssten der in Art. 9 Abs. 3 geschützten Tarifautonomie Rechnung tragen. Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen treffen, dass bei der Verdrängung von Tarifverträgen nach § 4a TVG nicht die Interessen einzelner Berufsgruppen oder Branchen einseitig vernachlässigt werden. Das Urteil erging mit mit sechs von acht Richterstimmen – nur eine Richterin und ein Richter des Senats hatten sich in einem Minderheitsvotum dafür ausgesprochen, § 4a TVG für nichtig zu erklären. Was heißt das für die Praxis? Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufgegeben, dies bis 31. Dezember 2018 im Gesetz zu regeln. Bis dahin sei die Kollisionsregel in § 4a TVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein Tarifvertrag im Falle einer Kollision nur verdrängt werden darf, wenn plausibel dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belange der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft »angemessen und wirksam« in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt hat. Dies müssen im Einzelfall dann die Fachgerichte, also die Arbeitsgerichte entscheiden.
7 Fragen zur Erreichbarkeit im Urlaub Sommerzeit ist Ferienzeit. Für viele beginnt in diesen Tagen der verdiente Jahresurlaub. Doch was ist, wenn der Chef im Urlaub anruft? Oder die Kollegen Fragen haben? Muss der Arbeitnehmer dann reagieren? Muss das Diensthandy eingeschaltet bleiben? Wir haben Ihnen die 7 »heißesten« Fragen beantwortet. 1. Müssen Beschäftigte im Urlaub erreichbar sein? Nein. Der Urlaub dient der Erholung. Jeder Beschäftigte hat nach § 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Eine Erholung ist dann nicht gewährleistet, wenn der Beschäftigte ständig damit rechnen muss, zur Arbeit abgerufen zu werden. Auch das Beantworten von Telefonaten und E-Mails ist Arbeit und beeinträchtigt die Erholung. Nach dem BUrlG müssen Beschäftigte an ihren freien Tagen von der Arbeit komplett entbunden sein. Fazit: niemand muss im Urlaub erreichbar sein, auch dann nicht, wenn er ein Diensthandy hat. Urlaub ist Urlaub. 2. Was passiert, wenn im Arbeitsvertrag »ständige Erreichbarkeit« geregelt ist? Vermehrt finden sich in Arbeitsverträgen Klauseln, die eine permanente Erreichbarkeit des Beschäftigten auch an seinen freien Tagen zur Pflicht machen – oder jedenfalls für ein paar Stunden pro Urlaubstag. Eine gern verwendete Klausel besagt, dass der Beschäftige einmal täglich die Mailbox abhören oder in einer bestimmten Zeit telefonisch erreichbar sein muss. Diese Vorgehensweise ist nicht zulässig – so das BAG in einem Urteil (20.6.2000 – 9 AZR 405/99). Dies gilt jedenfalls für die 24 Werktage, die jedem Angestellten als gesetzlicher Mindesturlaub zustehen. An allen zusätzlichen, vom Arbeitgeber freiwillig gewährten Urlaubstagen kann es allerdings vertraglich Sonderregeln geben. Klauseln im Arbeitsvertrag, die eine Erreichbarkeit an diesen Tagen vorsehen, sind nicht unzulässig. Der Chef dürfte dann permanente Erreichbarkeit verlangen. 3. Gilt etwas anders für Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst? Ja. In beiden Fällen muss der Beschäftigte permanent erreichbar sein, egal wo er sich gerade aufhält. Beides muss aber mit dem Arbeitgeber ausdrücklich vereinbart sein. Rufbereitschaft bedeutet, dass der Arbeitnehmer jederzeit für den Arbeitgeber erreichbar sein muss, um auf Abruf die Arbeit aufnehmen zu können. Bereitschaftsdienst ist dann gegeben, wenn sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort innerhalb oder außerhalb des Betriebs aufhalten muss, um bei Bedarf unverzüglich seine Arbeitstätigkeit aufnehmen zu können. In beiden Fällen dürfen die Mitarbeiter nicht im Urlaub sein. Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst und Urlaub schließen sich aus. Hinweis: Rufbereitschaft gilt nur dann als Arbeitszeit, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich zur Arbeit herangezogen wird, Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit. 4. Kann der Chef den Arbeitnehmer in Notfällen kontaktieren? Ja. Es gibt ganz wenige Notfälle oder Ausnahmesituationen, in denen der Arbeitgeber den Mitarbeiter im Urlaub anrufen oder kontaktieren darf. Das ist der Fall, wenn der Beschäftigte ein Passwort kennt, das der Betrieb dringend benötigt oder wenn sonst irgendein echter Notfall eintritt. Allerdings gilt hier, dass die Zeit der Erledigung der Anfrage für den Beschäftigten Arbeitszeit ist. Die muss vergütet werden. 5. Was gilt für Führungskräfte? Im Prinzip gilt auch für Führungskräfte rechtlich nichts anderes. Auch wenn sie ein Diensthandy haben, brauchen sie es im Urlaub nicht zu benutzen. Dienstliche Anrufe oder Mails können sie ignorieren. Auch für Führungskräfte gilt das Bundesurlaubsgesetz – und damit ist Urlaub arbeitsfreie Zeit. Allerdings kann es sein, dass es im Interesse der leitenden Angestellten oder Führungskräfte steht, dass die Geschäfte auch während ihrer Abwesenheit weiter laufen. Aber das müssen sie dann selbst entscheiden – eine rechtliche Verpflichtung gibt es nicht. 6. Kann der Arbeitnehmer gekündigt werden, wenn er nicht erreichbar ist? Nein. Keinesfalls. Selbst wer als urlaubender Angestellter den Anruf oder die Kontaktaufnahme verweigert, muss keine Sorge haben, dass ihn nach der Rückkehr aus dem Urlaub die Kündigung erwartet. Es könnte nur eine verhaltensbedingte Kündigung sein. Diese verlangt immer eine vorherige Abmahnung. Dem Arbeitnehmer muss ein Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten vorgeworfen werden, was aber im Falle eines Urlaubs nicht möglich ist. 7. Müssen Lehrkräfte während der Schulferien erreichbar sein? Ja. Schulferien sind für angestellte Lehrkräfte im Allgemeinen eine unterrichtsfreie, aber keine arbeitsfreie Zeit. Die Lehrkraft bleibt grundsätzlich zur Erledigung aller arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten verpflichtet. Der Arbeitgeber kann der Lehrkraft im Rahmen billigen Ermessens i.S.v. § 106 Satz 1 GewO verbindlich die Weisung erteilen, während der Schulferien zur Erfüllung bestimmter Aufgaben in der Schule anwesend zu sein. Anderes gilt nur, wenn die Weisung höherrangiges Recht verletzt, weil etwa die Höchstarbeitszeit überschritten oder der Urlaubsanspruch der Lehrkraft beeinträchtigt wird (BAG 16.10.2007 – 9 AZR 144/07).
KANN EIN KIND STEUERLICH ZWEI VÄTER HABEN? Jedes Kind hat im Normalfall nur einen einzigen Vater. Es gibt aber besondere Konstellationen, in denen ein Kind auch zwei Väter haben kann – einen im biologischen und einen im familienrechtlichen Sinn. Wie diese doch recht ungewöhnliche Situation erbschaftsteuerlich zu betrachten ist, musste jetzt das Hessische Finanzgericht (FG) entscheiden. Frau hat zwei Väter Eine junge Frau wurde 1987 geboren und wuchs ganz normal in einer Familie auf. Als sie im Jahr 2005 volljährig wurde, erfuhr sie, dass ihr biologischer Vater nicht der Ehemann ihrer Mutter ist. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich trotzdem ein tiefes und vertrauensvolles Verhältnis zur Familie des biologischen Vaters, auch zu dessen Ehefrau und dem leiblichen Sohn dieses Paares. Nachdem der biologische Vater seine Vaterschaft bereits im Jahr 1994 mit notarieller Urkunde anerkannt hatte, wurde die biologische Vaterschaft schließlich im Jahr 2015 durch eine Genanalyse festgestellt. Schlechtere Steuerklasse für Geldschenkung Im Jahr 2016 schenkte der biologische Vater und spätere Kläger seiner leiblichen Tochter einen größeren Geldbetrag und reichte beim zuständigen Finanzamt (FA) eine Schenkungsteuererklärung ein, in der er die Berücksichtigung der Steuerklasse I beantragte. Das FA setzte für diese Schenkung jedoch die schlechtere Steuerklasse III an und begründete dies damit, dass die Steuerklasse I nur im familienrechtlichen Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern gilt. Da die Beschenkte im familienrechtlichen Sinn die Tochter des Ehemanns der Mutter ist, ist die rechtliche Anerkennung der Vaterschaft des biologischen Vaters zivilrechtlich ausgeschlossen. Klage erfolgreich Nachdem das Einspruchsverfahren erfolglos verlaufen ist, erhob der Mann schließlich Klage beim Hessischen FG – mit Erfolg. Die Richter stellten fest, dass sowohl der Schenkungsteuerbescheid als auch die Einspruchsentscheidung rechtswidrig sind und den Kläger in seinen Rechten verletzen. Begriff Kind nicht definiert Gem. § 15 Abs. 1 S. 1 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) werden grundsätzlich drei Steuerklassen unterschieden, wobei nach § 15 Abs. 1 Steuerklasse I Nr. 2 ErbStG Kinder und Stiefkinder der Steuerklasse I unterfallen. Zur Auslegung des Bergriffs Kind wird auf die Regelungen des bürgerlichen Rechts Bezug genommen, wobei in diesem Zusammenhang sowohl die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) als auch die des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu beachten ist. Besondere Bindung zum biologischen Vater Der EGMR hat anerkannt, dass zwischen einem Kind und seinem biologischen Vater eine natürliche unveränderliche Bindung besteht, die beim Vorliegen einer engen persönlichen Beziehung dem Schutzbereich des Privat- und Familienlebens gem. Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) unterfällt. Weiterhin hat der deutsche Gesetzgeber im Jahr 2013 den § 1686a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eingeführt. Durch diese Regelung wurde der leibliche, aber nicht rechtliche Vater als eine besondere Ausprägung der Vaterschaft anerkannt und ihm wurden eigene Rechte zugesprochen. Übertragung auf Schenkungen Die Richter des FG kamen in ihrem Urteil zu dem Ergebnis, dass diese zivilrechtliche Entwicklung auf das Schenkungsteuerrecht angewendet werden muss. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der persönlichen Verhältnisse ist der Zeitpunkt der Zuwendung. Nachdem die Geldzuwendung des biologischen Vaters an seine Tochter innerhalb einer gefestigten Vater-Tochter-Beziehung stattfand, muss diese unter Berücksichtigung der Steuerklasse I erfolgen, da es sich um eine Zuwendung an ein Kind i. S. d. § 15 Abs. 1 Steuerklasse I Nr. 2 ErbStG handelt. Aus diesem Grund war der Schenkungsteuerbescheid fehlerhaft – weder der Kläger noch die Tochter mussten aufgrund des Freibetrags i. H. v. 400.000 Euro Schenkungsteuer zahlen. Für die Zukunft ist beachten, dass Zuwendungen oder Erbschaften ihres rechtlichen Vaters aber auch der Steuerklasse I unterfallen werden. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Fragen wurde Revision zum BFH (Az.: II R 5/17) zugelassen. (Hessisches FG, Urteil v. 15.12.2016, Az.: 1 K 1507/16)
FENSTERPUTZEN BEIM AUSZUG – PFLICHT DES MIETERS? Viele Mieter haben sich bestimmt schon einmal die Frage gestellt, ob sie verpflichtet sind, die Fenster ihrer Mietwohnung beim Auszug zu putzen. Wie so oft kommt es darauf an, was im Mietvertrag steht. Reinigungspflicht des Mieters Grundsätzlich hat der Mieter Hauptpflichten und Nebenpflichten, die er im Mietverhältnis mit seinem Vermieter erfüllen muss. Hauptpflicht ist, die Miete pünktlich und regelmäßig an seinen Vermieter zu zahlen, eine Nebenpflicht ist der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache – dazu gehört beispielsweise, dass die Wohnung geputzt, gelüftet und geheizt werden muss. Allerdings ist dabei zu beachten, dass es allein Sache des Mieters ist, wann und wie er die Wohnung, einschließlich der Fenster, putzt. Keine Gefahr durch schmutzige Fenster Auch wenn es viele Vermieter nicht gerne hören und anderer Meinung sind, so ist zu beachten, dass dreckige Fenster weder eine Gefährdung noch eine Verschlechterung der Mietsache darstellen und es auch zu keinen Beschädigungen an den Fenstern kommt, wenn der Mieter die Fenster entweder gar nicht oder nicht regelmäßig putzt – in keinem der Fälle liegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Mieters vor. Aus diesem Grund kann der Vermieter auch nicht abmahnen oder sogar kündigen. Beim Auszug keine Putzpflicht Im vorliegenden Fall klagte ein Vermieter gegen seinen Mieter, weil er unter anderem die Fenster beim Auszug nicht geputzt hatte. Doch die Richter des Landgerichts (LG) Berlin stellten fest, dass ein Mieter beim Auszug aus einer Wohnung nach § 546 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zwar eine Rückgabepflicht der Mietsache hat, dass er aus dem Mietvertrag grundsätzlich aber nicht verpflichtet ist, beim Auszug die Fenster zu reinigen. Besenreine Rückgabe Ist im Mietvertrag vereinbart, dass die Rückgabe der Wohnung besenrein zu erfolgen hat, so hat der Bundesgerichtshof (BGH) bereits in einem älteren Urteil (BGH, Urteil v. 28.06.2006, Az.: VIII ZR 124/05) entschieden, dass insgesamt nur grobe Verschmutzungen zu beseitigen sind – also solche, die über normale Abnutzungen und Gebrauchsspuren des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache hinausgehen. Daher müssen beispielsweise Spinnweben an den Fenstern entfernt, die Fenster selbst aber nicht geputzt werden. Rückgabe im sauberen Zustand Wurde im Mietvertrag eine Rückgabe im sauberen Zustand vereinbart, so haben Richter des Amtsgerichts (AG) Aachen (AG Aachen, Urteil v. 29.11.2007, Az.: 6 C 352/07) entschieden, dass der Mieter in diesem Fall die Fenster vor dem Auszug putzen muss. Es genügt in diesem Fall eine normale Reinigung, eine ausgiebige Reinigung ist jedoch nicht notwendig und kann auch nicht verlangt werden. (LG Berlin, Urteil v. 08.03.2016, Az.: 63 S 213/15)
SICHER DURCH DEN STAU IN DIE SOMMERFERIEN Endlich Sommerferien auch in Bayern. Das sorgt für viel Verkehr – und sicher auch für so manchen Stau, durch den Sie mit diesen Tipps sicherer hindurchkommen. Plötzlich Stau: Warnblinken mehr als erlaubt Jeder hat das sicher schon erlebt: Plötzlich steht der Verkehr vor einem. Und nicht selten klingt mit dem Stauende vor Augen die Stauwarnung aus dem Radio in den Ohren. Frühzeitig bremsen lautet dann die Devise und am besten das Warnblinklicht einschalten, um andere vor der Staugefahr zu warnen. Die Annäherung an einen Stau ist dabei sogar ein ausdrücklich genanntes Beispiel, das den Warnblinkereinsatz erlaubt. Verpflichtend ist das Warnblinken laut § 16 Straßenverkehrsordnung (StVO) jedoch beim Zufahren auf ein Stauende nicht. Dennoch sollte man aber so tun, als ob es eine Pflicht gäbe, damit andere Verkehrsteilnehmer hinter einem rechtzeitig durch Bremsen reagieren können. Ausfahrt verpasst: Dennoch gibt es kein Zurück Auch folgende Situation kennen viele: Der Stau kommt gerade dann, wenn die letzte Ausfahrt gerade hinter einem liegt. Auch bei einem Stau gibt es kein Zurück mehr, um die Autobahn zu verlassen. Wenden oder rückwärts fahren auf der Autobahn ist auch dann verboten, wenn der Verkehr steht. Selbst ohne Gefährdung drohen ein Bußgeld von 200 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Mit Gefährdung sind es 240 Euro Bußgeld samt der bereits genannten Folgen. Nicht zur Nachahmung empfohlen ist auch folgendes Verhalten: „Schlaue“ Verkehrsteilnehmer, die sich im Stau neben einer Zufahrt befanden, haben auch schon versucht, die Autobahn darüber zu verlassen. Dafür müssen sie regelmäßig eine enge Rechtskurve fahren. Dabei verstoßen sie zwar nicht gegen das Wendeverbot, da es eine 180-Grad-Wende voraussetzt. Auch das Rückwärtsfahrverbot ist ohne Einlegen des Rückwärtsgangs nicht verletzt. Wer die Autobahn über die Zufahrt verlässt, verlässt sie aber an einer hierfür nicht zugelassenen Stelle. Und das ist wie das Wenden und Rückwärtsfahren ebenfalls durch § 18 StVO verboten. Schließlich besteht dabei ein enormes Unfallrisiko mit auf der Zufahrt entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein Unfall bringt neben einem variablen Bußgeld 3 Punkte in Flensburg. Und nicht zuletzt kann die Vollkaskoversicherung wegen grob fahrlässigem Verhaltens die Leistung verweigern. Seitens der Kfz-Haftpflicht droht zumindest ein Regress. Rettungsgasse sofort bilden: Die rechte Hand hilft Rettungsgassen retten Leben! Das ist einigen Verkehrsteilnehmern aber leider nicht bewusst, wie Berichte über nicht oder unzureichend gebildete Rettungsgassen zeigen. Manche meinen zudem, dass sie die Rettungsgasse für sich nutzen dürfen. Auch bei dem kürzlich auf der A9 ausgebrannten Reisebus, in dem 18 Menschen starben, wurde keine ausreichende Rettungsgasse gebildet. Dabei ist jeder Fahrer dazu verpflichtet, sobald der Verkehr stockt und ein Stau zu entstehen droht. Wann stockt der Verkehr? Lange Zeit war das unklar. Durch eine seit Anfang 2017 geltende Änderung steht fest, dass die Rettungsgasse zu bilden ist, sobald Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Wer sich unsicher ist, wie das mit der Rettungsgasse nochmal geht, sollte seinen rechten Handrücken betrachten. Stellt man sich den Daumen als linke Fahrspur vor, liegt die Rettungsgasse immer zwischen ihm und den restlichen Fingern, die für die anderen Fahrspuren stehen. Die Rettungsgasse ist immer zwischen der linken Fahrspur und den übrigen Spuren zu bilden. Und die Rettungsgassenpflicht endet erst, wenn der Verkehr wieder rollt und nicht schon mit dem Vorbeifahren der ersten Rettungsfahrzeuge. Schließlich können noch mehr Rettungskräfte zur Unfallstelle unterwegs sein. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld von 20 Euro – aber nicht mehr lange. Bundesverkehrsminister Dobrindt sieht das Bußgeld infolge der zunehmenden Probleme falsch gebildeter Rettungsgassen künftig bei 115 Euro plus 1 Punkt in Flensburg. Der Bundesrat schlägt sogar ein Bußgeld von mindestens 200 Euro vor und empfiehlt zudem die Verhängung von Fahrverboten. In Österreich liegt das Bußgeld schon jetzt bei 726 Euro für jeden, der die Rettungsgasse nicht richtig bildet. Wer die Rettungsgasse dort zudem befährt und Rettungsfahrzeuge behindert, zahlt sogar bis zu 2180 Euro. Seitdem funktioniert es auf österreichischen Autobahnen besser mit der Rettungsgasse. Auch bei stehendem Verkehr: Aussteigen nicht erlaubt Steht der Verkehr, steigen viele Fahrzeuginsassen aus. Das ist auf Autobahnen auch bei Stau nicht erlaubt. Ausnahmen vom Verbot, die Autobahn zu Fuß zu betreten, gelten nur in Notfällen oder zur Unfallsicherung. Wer sein Fahrzeug bei längerem Stehen verlässt, sollte das nur mit größter Vorsicht tun. Gerade am Stauende können nachkommende Fahrzeuge – insbesondere Lkw – zu spät bremsen. Die Folgen kann sich jeder vorstellen. Wer im Tunnel steht, sollte zudem nach kurzer Zeit den Motor ausschalten. Geht die Tanknadel in Richtung null, sollte man rechtzeitig auf den Standstreifen wechseln. Das ist allemal besser als auf der Fahrbahn zu stehen, wenn der Verkehr wieder rollt. Seitenstreifen für Pannen gedacht: nicht zur Abkürzung Im Übrigen darf man den Seitenstreifen nur im Fall einer Panne befahren oder darauf halten, deshalb auch die Bezeichnung als Pannenstreifen. Eine Ausnahme gilt zudem, wenn sonst kein Platz für eine Rettungsgasse bleibt. Den Standstreifen benutzen darf man zudem, wenn Polizei, Schilder oder Markierungen es etwa wie häufig bei Baustellen erlauben. Keine Ausnahme bildet aber die Möglichkeit, die Autobahn vor einer Ausfahrt über den Standstreifen schneller zu verlassen oder einfach zu einer Raststätte zu gelangen. Oft kommt es gerade zu Unfällen, weil plötzlich ein anderer auf dieselbe Idee kommt und auf den Seitenstreifen ausschert. Dann ist dieser ebenfalls blockiert und behindert Rettungskräfte. Diese dürfen den Standstreifen anders als normale Verkehrsteilnehmer befahren. Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind insofern von der Straßenverkehrsordnung befreit. Sie müssen allenfalls das Blaulicht benutzen, nicht jedoch unbedingt die Sirene, wenn sie sich wie auf der Autobahn außerorts befinden. Auf dem Standstreifen können zudem auch Menschen laufen, die die nächste Notrufsäule suchen. Wer diese verletzt, haftet in der Regel allein. Die nächste Notrufsäule findet man leicht durch Blick auf die weißen Begrenzungspfähle. Kleine schwarze Pfeile darauf zeigen in Richtung der nächstgelegenen Notrufsäule. Auch in Zeiten allgegenwärtiger Handys werden die im Abstand von 2 km befindlichen Säulen immer noch gerne genutzt.
WELCHER URLAUBSANSPRUCH GILT BEI TEILZEIT? Was viele Teilzeitbeschäftigte nicht wissen, ist, dass es für ihren Urlaubsanspruch völlig unerheblich ist, wie viele Stunden sie pro Tag arbeiten, denn für die Berechnung sind nur die Arbeitstage pro Woche ausschlaggebend. In diesem Rechtstipp erfahren Sie, warum das so ist und wie die Urlaubstage genau berechnet werden. Immer mehr Teilzeitbeschäftigte In Deutschland arbeiten immer mehr Menschen in Teilzeit. Nach aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg arbeiteten im Jahr 2016 bereits 39 Prozent aller Arbeitnehmer in Teilzeit. D. h., 4 von 10 Beschäftigten haben keine Vollzeitstelle mehr. Allerdings arbeiten mehr Frauen als Männer in Teilzeit – knapp 80 Prozent der Teilzeiterwerbstätigen sind Frauen. Urlaubsanspruch ist gesetzlich geregelt Im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) ist der Anspruch auf bezahlten Urlaub von Arbeitnehmern – also Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, Auszubildenden, Heimarbeitern oder Minijobbern – gesetzlich geregelt und entsteht, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens einen Monat besteht. Nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses hat jeder Arbeitnehmer i. S. d. § 4 BUrlG Anspruch auf alle vereinbarten Urlaubstage. In § 3 BUrlG ist geregelt, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf mindestens 24 Werktage – dazu gehört auch der Samstag, nicht jedoch Sonn- und Feiertage –Erholungsurlaub hat. Folglich haben alle Arbeitnehmer mit einer Sechs-Tage-Woche einen Anspruch auf mindestens 24 Tage Urlaub, Arbeitnehmer mit einer Fünf-Tage-Woche haben dann entsprechend nur noch 20 Tage – dies entspricht aber jeweils vier Wochen Erholungsurlaub. Allerdings können in einem Arbeits- bzw. Tarifvertrag auch mehr Urlaubstage vereinbart werden. Urlaubsanspruch von Teilzeitbeschäftigten Ein Teilzeitbeschäftigter arbeitet – wie der Name schon sagt – nur einen Teil der wöchentlichen Arbeitszeit. Aus diesem Grund könnte man auf die Idee kommen, dass eine Teilzeitkraft auch weniger Urlaubsanspruch hat und somit die Urlaubstage gekürzt werden müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass sich der Urlaubsanspruch nur auf die geleisteten Arbeitstage und eben nicht auf die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden bezieht. Dies hat zur Folge, dass jeder Teilzeitbeschäftigte, der an allen Werktagen arbeitet, Anspruch auf dieselbe Anzahl von Urlaubstagen hat wie ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Berechnung des Urlaubsanspruchs Der Urlaubsanspruch eines Teilzeitbeschäftigten muss also immer dann gekürzt werden, wenn er nicht an jedem Werktag der Woche arbeitet. In diesem Fall muss der individuell vereinbarte Urlaub auf die geleisteten Arbeitstage umgerechnet werden. Hierzu gibt es aber eine einfache Formel zur Berechnung des reduzierten Urlaubsanspruchs: Vereinbarte Urlaubstage : Anzahl der Werktage der Firma x Arbeitstage des Teilzeitarbeitnehmers = Urlaubsanspruch in Tagen. Wenn beim Ergebnis Bruchteile von Urlaubstagen entstehen und diese mindestens einen halben Tag ergeben, müssen diese nach § 5 Abs. 2 BUrlG auf volle Urlaubstage aufgerundet werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass von dieser Regelung insbesondere in Tarifverträgen abgewichen werden kann. Beispiel: Es wurden im Arbeitsvertrags 26 Urlaubstage vereinbart, in der Firma wird an fünf Tagen pro Woche gearbeitet und der Teilzeitbeschäftigte kommt an 4 Tagen der Woche zur Arbeit: 26 : 5 x 4 = 20,8 Das Ergebnis muss gem. § 5 Abs. 2 BUrlG auf 21 Tage Urlaubstage aufgerundet werden. Problem: Unregelmäßige Teilzeitarbeit Falls ein Teilzeitarbeitnehmer unregelmäßig arbeitet – also nicht jede Woche an gleich vielen Arbeitstagen – muss die Berechnung des Urlaubsanspruchs anders erfolgen. Da in diesem Fall eine normale Arbeitswoche nicht als Berechnungsgrundlage herangezogen werden kann, bildet die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Jahres die Berechnungsgrundlage. Die Formel zur Berechnung des Urlaubsanspruchs lautet in diesem Fall: Vereinbarte Urlaubstage : Jahreswerktage der Firma x Anzahl der Arbeitstage des Teilzeitarbeitnehmers im Kalenderjahr = Urlaubsanspruch in Tagen. Auch hier gilt, dass anteilige Urlaubstage, die mehr als einen halben Tag ergeben, gem. § 5 Abs. 2 BUrlG aufgerundet werden müssen. Urlaubsanspruch bei Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit Einen weiteren Sonderfall bildet der Wechsel eines Arbeitnehmers von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle im laufenden Jahr. Hier war es in der Vergangenheit so, dass der gesamte Urlaubsanspruch des Jahres an die reduzierte Anzahl der Arbeitstage angepasst wurde – die Urlaubsansprüche aus der Vollzeittätigkeit wurden also reduziert. Schließlich beschloss der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass dann ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten vorliegt, wenn der Urlaubsanspruch aufgrund eines Wechsels von einer Voll- in eine Teilzeitbeschäftigung gekürzt wird – folglich darf der während der Vollzeitbeschäftigung erworbene Urlaub nicht gemindert werden (EuGH, Beschluss v. 13.06.2013, Az.: C 415/12). Allerdings muss eine gesonderte Berechnung für den Urlaub der Vollzeit- und der Teilzeittätigkeit vorgenommen werden. Nachdem diese Entscheidung im deutschen Arbeitsrecht umgesetzt werden musste, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG), dass die Urlaubstage, die ein Arbeitnehmer während seiner Vollzeittätigkeit erworben hat, nicht wegen eines Wechsels in Teilzeitbeschäftigung gekürzt werden dürfen. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer diese Urlaubstage vor der Reduzierung seiner Arbeitszeit und bei weniger Wochenarbeitstagen als bisher nicht mehr vollständig nehmen kann (BAG, Urteil v. 10.02.2015, Az.: 9 AZR 53/14 (F)).
Quiz